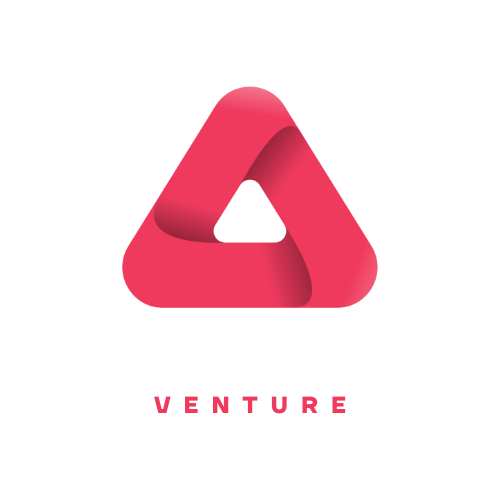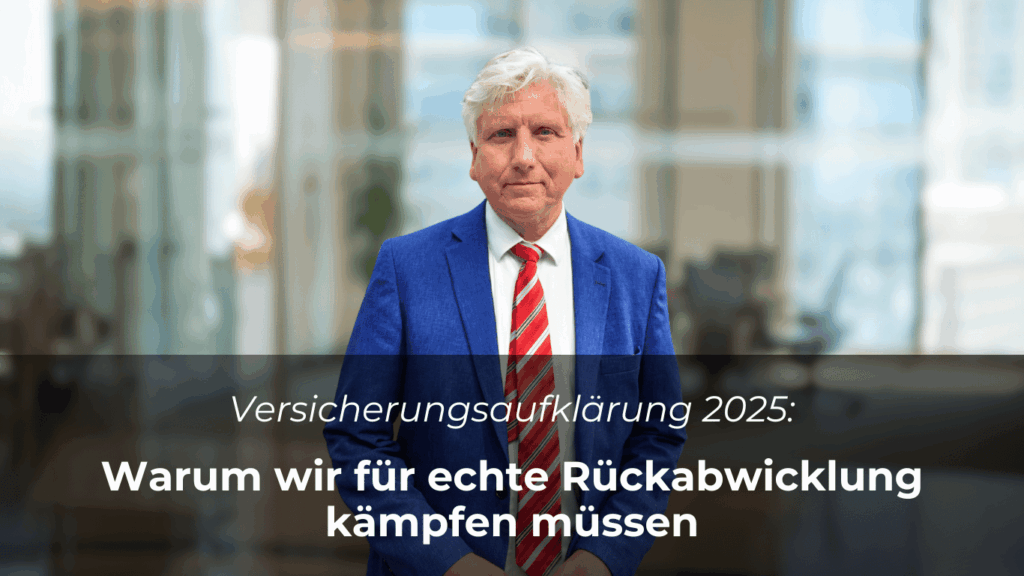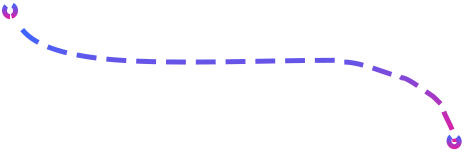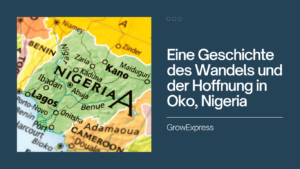Der große Aha-Moment steht bevor – für Millionen Versicherte. Vertrauen verspielt – Versicherer auf dem Prüfstand.
In den nächsten Jahren rollt eine Welle auf Deutschland zu, die nicht nur demografisch, sondern auch juristisch und finanziell enorme Sprengkraft hat: Millionen Baby-Boomer erreichen das Ende ihrer Lebensversicherungsverträge – Verträge, die einst mit stolzen Worten, soliden Hochrechnungen und einem Versprechen fürs Alter verkauft wurden. Doch was viele erwartet, ist kein warmer Geldregen, sondern eine kalte Dusche der Realität.
Denn was jahrzehntelang als „sichere Altersvorsorge“ galt, entpuppt sich bei Auszahlung oft als kostspielige Enttäuschung. Laut aktuellen Daten der BaFin (2024) liegt die durchschnittliche Ablaufleistung bei vielen klassischen Lebensversicherungen bis zu 30 Prozent unter den ursprünglich in Aussicht gestellten Summen. Dabei fließt ein erheblicher Teil der einbezahlten Beiträge in Abschlusskosten, Verwaltung und Rückstellungen, anstatt in die versprochene Rendite. Gewinnanteile, die vertraglich zugesagt wurden, bleiben häufig im System – auf der Seite der Versicherer.
Rechtsanwalt Dr. Thomas Schulte, seit über zwei Jahrzehnten auf Kapitalanlagerecht spezialisiert, bringt es auf den Punkt: „Was viele Verbraucher nicht wissen: Sie haben Anspruch auf mehr – aber sie müssen ihn beweisen. Das bedeutet: Rechnen, einfordern, notfalls klagen. Wer seine Rechte nicht kennt, verliert Geld. Wer sie kennt, kann sie durchsetzen.“
Gemeinsam mit unabhängigen Experten wie Sven Enger und Werner Hochgrefe, die sich seit Jahren für die rechtliche und wirtschaftliche Aufarbeitung in der Lebensversicherungsbranche starkmachen, beginnt sich nun eine Aufklärung durchzusetzen, die lange überfällig ist. Erste gerichtliche Erfolge bei der Rückabwicklung unter fehlerhaften Belehrungen (§ 5a VVG a.F.) oder bei intransparenten Überschussverteilungen zeigen: Es lohnt sich, genau hinzusehen – und zu handeln.
Was bleibt am Ende wirklich übrig – und warum so wenig?
Immer mehr Versicherte stehen vor dem großen Moment: Die Lebensversicherung wird fällig. Doch statt Freude und finanzieller Sicherheit mischen sich bei vielen plötzlich Zweifel, Ärger und Enttäuschung. Wo ist das ganze Geld hin? Warum ist die Auszahlung deutlich niedriger als erwartet? Und was steckt hinter den vielen Kürzungen, Abzügen und schwammigen Begriffen wie „Stornoabschlag“ oder „Überschussbeteiligung“?
Dieser Artikel wirft genau die Fragen auf, die sich jetzt Millionen Betroffene stellen – und die oft viel zu lange unbeantwortet blieben:
Dürfen Versicherer einfach so Leistungen kürzen? Welche Rechte habe ich als Kunde eigentlich wirklich? Wie kann ich prüfen, ob meine Auszahlung korrekt berechnet wurde? Was, wenn mir über Jahre hinweg zu wenig gutgeschrieben wurde – kann ich das zurückfordern? Und warum wird all das nicht offensiver kommuniziert – von Vermittlern, Politik oder Medien?
Verbraucher fragen sich, wie Kosten versteckt, Erwartungen enttäuscht und Ansprüche kleingerechnet werden – und welche juristischen Hebel es gibt, um sich zu wehren. Denn der große Auszahlungszyklus der Baby-Boomer hat begonnen – und mit ihm die wohl wichtigste Auseinandersetzung um Vertrauen, Transparenz und Fairness in der deutschen Versicherungsgeschichte.
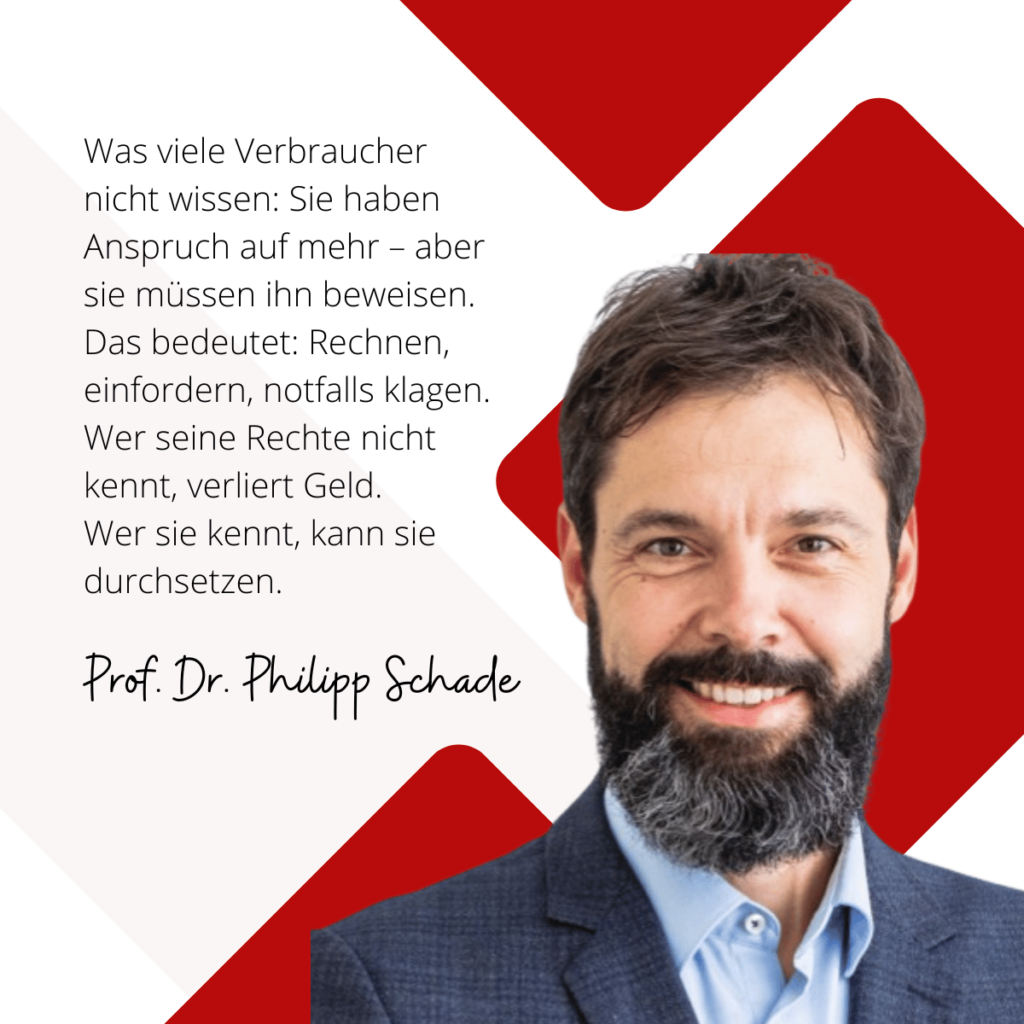
Die Rolle der Deckungsrückstellungen – ein verdecktes Geschäftsmodell
Wer einen Blick in die Bilanzen großer Lebensversicherer wirft, stößt unweigerlich auf ein zentrales Element: die Deckungsrückstellungen. Dabei handelt es sich um milliardenschwere Beträge, die auf der Passivseite der Bilanz auftauchen – offiziell als Verpflichtungen gegenüber den Versicherten. Juristisch betrachtet ist klar: Das ist Fremdgeld, also Guthaben der Kunden, nicht Eigentum des Versicherers. Doch was sich auf dem Papier eindeutig liest, wird in der Realität zum Kalkulationsspielraum für die Versicherung – oft zulasten der Versicherten.
Diese Rückstellungen entstehen aus laufenden Beiträgen, insbesondere aus Sicherheitszuschlägen, die ursprünglich dazu dienen sollten, Risiken wie Zinsänderungen oder unerwartet hohe Lebenserwartungen abzusichern. Doch genau diese Sicherheitsreserven werden faktisch nie an die Kunden ausgezahlt – weder bei Vertragsende noch im Todesfall. Sie verbleiben im Unternehmen und polstern die Kapitalanlagen auf, mit denen wiederum neue Rendite erwirtschaftet wird – allerdings für das Unternehmen, nicht für den Kunden.
Ein einfaches Beispiel:
Frau M. hat über 30 Jahre hinweg eine klassische Lebensversicherung mit einem Monatsbeitrag von 150 Euro bedient. In dieser Zeit hat sie rund 54.000 Euro eingezahlt. Die Versicherung weist eine garantierte Leistung von ca. 52.000 Euro aus, die durch eine „Überschussbeteiligung“ auf 58.000 Euro steigen könnte – so die Hochrechnung bei Vertragsbeginn. Als sie den Vertrag nun zum Laufzeitende 2024 kündigt, erhält sie aber nur 47.800 Euro ausgezahlt. Auf Nachfrage wird auf „marktbedingte Schwankungen“, „stille Reserven“ und „kollektivbezogene Risikoabschläge“ verwiesen.
Der Knackpunkt: In den Bilanzen des Versicherers ist Frau M.’s Anteil an der Deckungsrückstellung mit rund 61.000 Euro gelistet – inklusive aller kalkulierten Sicherheitszuschläge. Doch dieser Betrag fließt nicht an sie zurück, obwohl es sich bilanziell um eine „Verpflichtung“ handelt. Das System lebt davon, dass ein Teil der Rückstellungen intern umgebucht oder „stillgelegt“ wird, anstatt transparent und verursachungsgerecht ausgeschüttet zu werden.
So wird aus dem Schutzinstrument Deckungsrückstellung ein verdecktes Geschäftsmodell: Was als Absicherung beginnt, endet für viele Kunden als nicht eingelöstes Versprechen, dessen Rückseite nur Fachleute lesen können – und das in der Praxis oft unangetastet bleibt, solange niemand die richtigen Fragen stellt.
Berechnungsmethode nach dem BGH – und warum sie neue Chancen eröffnet
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat im Urteil vom 29. April 2020 (Az. IV ZR 5/19) klargestellt: Versicherungsnehmer müssen die Ertragslage des Versicherers konkret darlegen, um Nutzungsansprüche – also etwa Zinsen auf zurückzuzahlende Beiträge bei Rückabwicklung – wirksam geltend machen zu können. Damit wurde ein hoher Maßstab an die Anspruchsbegründung gesetzt. Es reicht nicht, pauschal zu behaupten, die Versicherung habe mit dem Geld Gewinne erwirtschaftet – der Versicherte muss zahlenbasiert nachweisen, wie hoch diese Erträge mutmaßlich waren.
Diese Herausforderung wurde von Experten wie Prof. Dr. Philipp Schade methodisch aufgegriffen. Er entwickelte ein Modell, bei dem der Rohüberschuss – ein offizieller Gewinnbegriff der BaFin – in Relation zu den gesamten Beitragseinnahmen des Versicherers gesetzt wird. Daraus ergibt sich eine faktisch erzielte Durchschnittsverzinsung, die deutlich aussagekräftiger ist als die oft beschönigten „Nettoverzinsungen“ oder Hochglanz-Performanceberichte der Versicherer.
Ein praxisnahes Beispiel:
Ein Versicherungsnehmer hatte über 20 Jahre rund 40.000 Euro an Beiträgen in seine Lebensversicherung eingezahlt. Der Rückkaufswert zum Zeitpunkt der Kündigung lag bei 31.500 Euro, was bereits einen massiven Verlust bedeutete. Der Versicherer verwies auf „niedrige Zinsen“ und „Kostenbelastungen“. Mithilfe der Schade-Methode wurde jedoch ermittelt, dass der betreffende Versicherer im betreffenden Zeitraum einen durchschnittlichen Rohüberschuss von 2,8 % pro Jahr auf die Beiträge seiner Versicherten erwirtschaftete. Bezogen auf die Beitragslaufzeit hätte dem Kunden demnach eine Ertragsgutschrift von rund 6.500 Euro zusätzlich zustehen können – was zu einem Rückkaufswert von über 38.000 Euro geführt hätte.
Die Methode macht damit erstmals greifbar, welcher wirtschaftliche Nutzen dem Versicherer aus den Beiträgen tatsächlich entstanden ist – und was dem Versicherten davon möglicherweise rechtswidrig vorenthalten wurde. Besonders in Rückabwicklungsfällen nach fehlerhafter Widerrufsbelehrung ist diese Berechnung ein zentrales Beweisinstrument, um den Anspruch auf Nutzungsersatz erfolgreich durchzusetzen.
Vergleich statt Urteil? Warum wir auf Durchsetzung bestehen?
Viele Versicherer versuchen, durch Vergleiche Urteile zu vermeiden. Doch wir sind bereit, konsequent durchzuklagen. Denn: Erste Vergleiche wurden bereits auf Basis unserer Berechnungen erzielt – mit enormem Mehrwert für den Kunden. Ein Beispiel: Bei eingezahlten 10.000 Euro wurde ein Vergleich in Höhe von 25.000 Euro erzielt. In einem anderen Fall wurde die Rückabwicklung trotz PAK-Zwischenschaltung (Treuhandgesellschaften) vom OLG Stuttgart bestätigt.
Ein Branchenproblem – keine Einzelfälle
Es geht nicht um einzelne Verträge. Die Kalkulation vieler Lebensversicherer basiert auf einem System, das heutige Beitragszahler zur Auszahlung alter Verträge heranzieht – ähnlich wie bei einem Schneeballsystem. Die Deckungsrückstellungen verschleiern diese Praxis. Die Kunden werden im Glauben gelassen, dass ihre Sparanteile und Sicherheitszuschläge „für sie“ investiert würden. Tatsächlich dienen sie jedoch der Finanzierung anderer Verträge – ohne Rückzahlung am Ende.
Widerruf, Rückabwicklung, Bereicherungsrecht – mehrere Anspruchsgrundlagen
Versicherungsnehmer haben mehr als nur eine Chance:
- Widerruf ist möglich, wenn die Vertragsinformationen intransparent sind – was regelmäßig der Fall ist, etwa bei Überschussbeteiligungen.
- Bereicherungsrechtlicher Anspruch besteht, wenn Sicherheitszuschläge dauerhaft einbehalten wurden.
- Vertraglicher Rückabwicklungsanspruch nach § 346 BGB greift bei falscher Abrechnung.
- Wucher (§ 138 BGB) kann vorliegen, wenn 81 % der Erträge im Unternehmen verbleiben und dem Kunden nicht zugutekommen.
Gutachten und juristische Argumentation – warum die Berechnungsmethode entscheidend ist
Im Zentrum der juristischen Auseinandersetzung steht eine komplexe, aber entscheidende Frage: Wie berechnet man den tatsächlichen Anspruch eines Versicherungsnehmers auf Nutzungsentschädigung oder Rückabwicklung? Der Bundesgerichtshof hat im Urteil vom 29.04.2020 – IV ZR 5/19 festgestellt, dass der Versicherungsnehmer die Ertragslage des Versicherers berücksichtigen muss, wenn er einen Nutzungsersatz beanspruchen will. Dies stellt eine Kehrtwende dar, denn bisher wurde häufig auf die Eigenkapitalrendite oder pauschale Nettoverzinsungen verwiesen – Maßstäbe, die weder transparent noch sachgerecht sind.
Die von Prof. Dr. Schade entwickelte Berechnungsmethode knüpft an den offiziellen „Rohüberschuss“ an, den die BaFin in ihren Jahresberichten dokumentiert. Der Rohüberschuss wird ins Verhältnis zu den eingenommenen Beiträgen gesetzt – eine Vorgehensweise, die sogar von der Aufsichtsbehörde selbst praktiziert wird. Daraus ergibt sich ein verzinslicher Nutzungssatz, der auf den konkreten Vertrag des Mandanten übertragen werden kann.
Juristisch bietet diese Methode gleich mehrere Vorteile:
- Transparenz: Sie basiert auf öffentlich zugänglichen Kennzahlen.
- Objektivität: Sie beruht auf offiziellen Unternehmensdaten und nicht auf Annahmen.
- Zulässigkeit: Da sie die vom BGH geforderte Bezugnahme auf die Ertragslage erfüllt, ist sie prozessual verwertbar.
Zudem wird bei der Bilanzanalyse berücksichtigt, dass bestimmte Positionen – etwa Deckungsrückstellungen – Gewinne reduzieren, obwohl diese Mittel faktisch im Unternehmen verbleiben und weiterarbeiten. Die Gutachten legen offen, dass ein erheblicher Teil der einbehaltenen Sicherheitszuschläge nicht für Risiken verbraucht wurde, sondern im Unternehmen zur Kapitalmehrung diente – ohne Beteiligung des Kunden.
Wichtig: Auch alternative Methoden wurden herangezogen, etwa durch Herrn Kleinlein, der das individuelle Beitragsvolumen ins Verhältnis zur Gesamtanlagequote der Versicherung setzte. Doch auch diese Methodik hat Schwächen, insbesondere wenn Altverträge berücksichtigt werden müssen. Die Schade-Methode hingegen fokussiert auf tatsächlich generierten Rohgewinn pro Beitrag – ein praktikabler und nachvollziehbarer Maßstab, der mittlerweile mehrfach zu erfolgreichen Vergleichsabschlüssen geführt hat.
Für Gerichte bedeutet das: Sie müssen nicht hypothetisch bewerten, sondern erhalten belastbare Zahlen und Berechnungen, die auf der Bilanzierung des jeweiligen Versicherers beruhen. In Zeiten komplexer Produkte und undurchsichtiger Vertragsbedingungen ist dies ein Durchbruch für die Rechtsdurchsetzung.
Warum Richter jetzt mitziehen müssen
Die Gerichte tun sich mit der Materie schwer – kein Wunder bei der Komplexität. Doch die Argumente überzeugen, wenn sie verständlich vorgelegt werden. Ziel ist ein Grundsatzurteil, das das System der verschleierten Gewinnabschöpfung aufdeckt und den Kunden ihren Anteil sichert. Der Schlüssel liegt in guter Vorbereitung, nachvollziehbarer Darstellung und professionellen Gutachten.
Was jetzt wichtig ist: Tempo, Koordination, Strategie
Je mehr Klagen gleichzeitig eingebracht werden, desto eher kippt das System. Deswegen übernehmen wir als Kanzlei die Koordination der Mandate, auch in Fällen, in denen andere Anwälte sich als überfordert oder ineffektiv erwiesen haben. Wer betroffen ist, sollte sich direkt an unsere Kanzlei wenden – wir sichern ab, prüfen und setzen Ihre Ansprüche durch.
Fazit: Die Zeit der halben Wahrheiten ist vorbei – jetzt beginnt eine Ära der Klarheit
Die Versicherungswirtschaft hat sich über Jahrhunderte entwickelt – aus ehrbaren Ursprüngen, getragen von Solidarität und dem Wunsch, Menschen in Not zu schützen. Doch im Laufe der Jahrzehnte ist daraus ein System geworden, das oft zu technisch, zu intransparent und zu wenig verbrauchernah agiert. Hinter Begriffen wie Deckungsrückstellung, Verwaltungskostenquote oder Überschussbeteiligung verbirgt sich für viele Kunden nichts Greifbares mehr – nur ein Gefühl: Am Ende kommt weniger heraus, als einst versprochen wurde.
Jetzt ist der Moment gekommen, innezuhalten. Nicht, um die Vergangenheit zu verdammen, sondern um sie mit Augenmaß und Verantwortung neu zu bewerten. Verbraucher, Vermittler und Versicherer sind keine Gegner – sie sind Teile eines Systems, das nur dann funktioniert, wenn Vertrauen herrscht. Vertrauen entsteht durch Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Fairness. Und genau das muss der neue Maßstab sein.
Auch für Vermittler bietet diese Entwicklung eine große Chance: Wer heute bereit ist, ehrlich zu beraten und aufzuklären, wird morgen als verlässlicher Partner wahrgenommen, nicht als Verkäufer. Und auch die Entscheider in den Versicherungsunternehmen haben es in der Hand, das System ethisch und zukunftsfähig auszurichten – nicht aus juristischem Zwang, sondern aus innerer Verantwortung.
Ja, es gab Fehler. Ja, es wurde zu viel hinter verschlossenen Türen gerechnet. Aber: Fehler kann man ausbessern. Der Mut, dies zu tun, ist kein Zeichen von Schwäche – sondern von Größe.
Was wir jetzt brauchen, ist ein klares Bekenntnis zu einer neuen Epoche der Versicherung: verständlich, fair, rechenschaftspflichtig. Eine Epoche, in der Verträge nicht mehr hinterfragt werden müssen, sondern aus sich selbst heraus überzeugen. Und in der das große Versprechen von Sicherheit und Fürsorge endlich wieder das hält, was es ursprünglich versprach.
Das ist möglich. Es beginnt mit Aufklärung. Es setzt sich fort mit Recht und Mathematik. Und es endet – im besten Fall – mit neuem Vertrauen in ein altes Versprechen: Wir sind füreinander da, wenn es darauf ankommt.
V.i.S.d.P
Dr. Rainer Schreiber
Dozent, Erwachsenenbildung & Personalberater
Über den Autor:
Personalberater und Honorardozent Dr. Rainer Schreiber, mit Studium der Wirtschaftswissenschaften mit den Schwerpunkten Finanzierung, Controlling, Personal- und Ausbildungswesen. Der Blog schreiber-bildung.de bietet die Themen rund um Bildung, Weiterbildung und Karrierechancen.
Kontakt
Rechtsanwalt Dr. Thomas Schulte
E-Mail: law@meet-an-expert.com
Pressekontakt
ABOWI UAB
Naugarduko g. 3-401
03231 Vilnius
Litauen
Telefon: +370 (5) 214 3426
E-Mail: contact@abowi.com
Internet: www.abowi.com