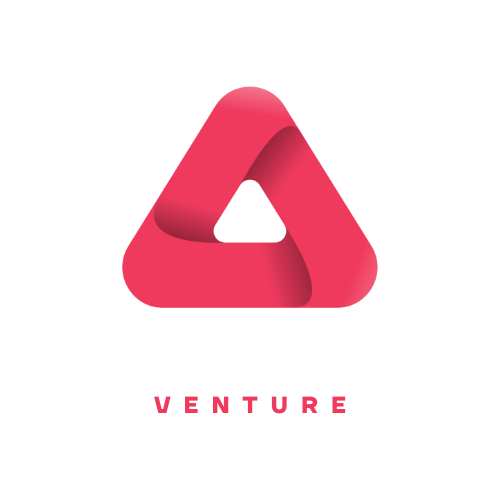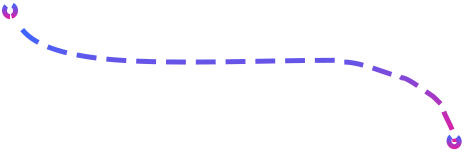Warum die Nacht Europas Zukunft bestimmt
Wer bestimmt den Takt unserer Städte nach Sonnenuntergang – die Elektronen im Kabel oder die inneren Uhren von Menschen, Tieren und Pflanzen? Und was passiert, wenn wir beides synchronisieren: Energie sparen, Sicherheit erhalten, Biodiversität schützen – ohne die Nacht zu verlieren? Genau hier setzt die Idee der zirkadianen Stadt an: eine Beleuchtung, die nicht nur effizient ist, sondern biologisch und ökologisch klug, datenfähig und rechtskonform. Der Biologe, Innovationsberater und Technologieentwickler Dr. Andreas Krensel bringt es auf den Punkt: Erst wenn Physik, KI, Biologie und Systemtheorie gemeinsam an einem urbanen Regelkreis arbeiten, entsteht eine Beleuchtung, die den Raum nicht einfach heller macht, sondern intelligenter.
Energie, Geld und Gesetz: Der neue Modernisierungsdruck
Der ökonomische Druck ist spürbar. Straßenbeleuchtung beansprucht zwar nur ein bis zwei Prozent des EU‑weiten Strombedarfs, verschlingt in Kommunen aber bis zu 40 bis 50 Prozent des eigenen Stromkontos. Jede eingesparte Kilowattstunde wirkt doppelt – für die Stadtkasse und fürs Klima. Gleichzeitig verpflichtet die revidierte Energieeffizienzrichtlinie die öffentliche Hand zu kontinuierlichen Einsparungen. Aus reiner Effizienz wird so ein Transformationsauftrag: raus aus dem Dauer‑Volllicht, hin zu Bedarf, Kontext und Gesundheit.
Chronobiologie als Stadttechnik: Licht für den inneren Takt
Die zirkadiane Stadt beginnt bei der Biologie. Licht synchronisiert unseren Schlaf‑Wach‑Rhythmus, steuert Melatonin und Wachsamkeit. Abends und nachts kann helle, kurzwellige Strahlung den Schlaf verschieben; tagsüber fördert gezieltes, aktivierendes Licht Leistung und Aufmerksamkeit. Leitlinien internationaler Gremien verdichten dieses Wissen zu einer einfachen Devise: das richtige Licht zur richtigen Zeit. Für die Praxis heißt das, dass spektrale Qualität, Timing, Intensität und Abschirmung ebenso zählen wie Lumen und Watt.
Der Himmel wird zu hell: Skyglow als Standortfaktor
Der globale Himmel hellt sich messbar auf, die Milchstraße verschwindet über Städten – ein ökologisches und kulturelles Warnsignal. Lichtverschmutzung irritiert Zugvögel, Fledermäuse, Insekten; sie verändert das Verhalten nachtaktiver Arten und die Balance ganzer Ökosysteme. Europa reagiert mit Empfehlungen für Abschirmungen, warmweiße Spektren und zeitlich begrenzten Betrieb. Wer Nachtqualität als Standortfaktor begreift, plant nicht nur Licht, sondern auch Dunkelheit – bewusst, dosiert, zielgenau.
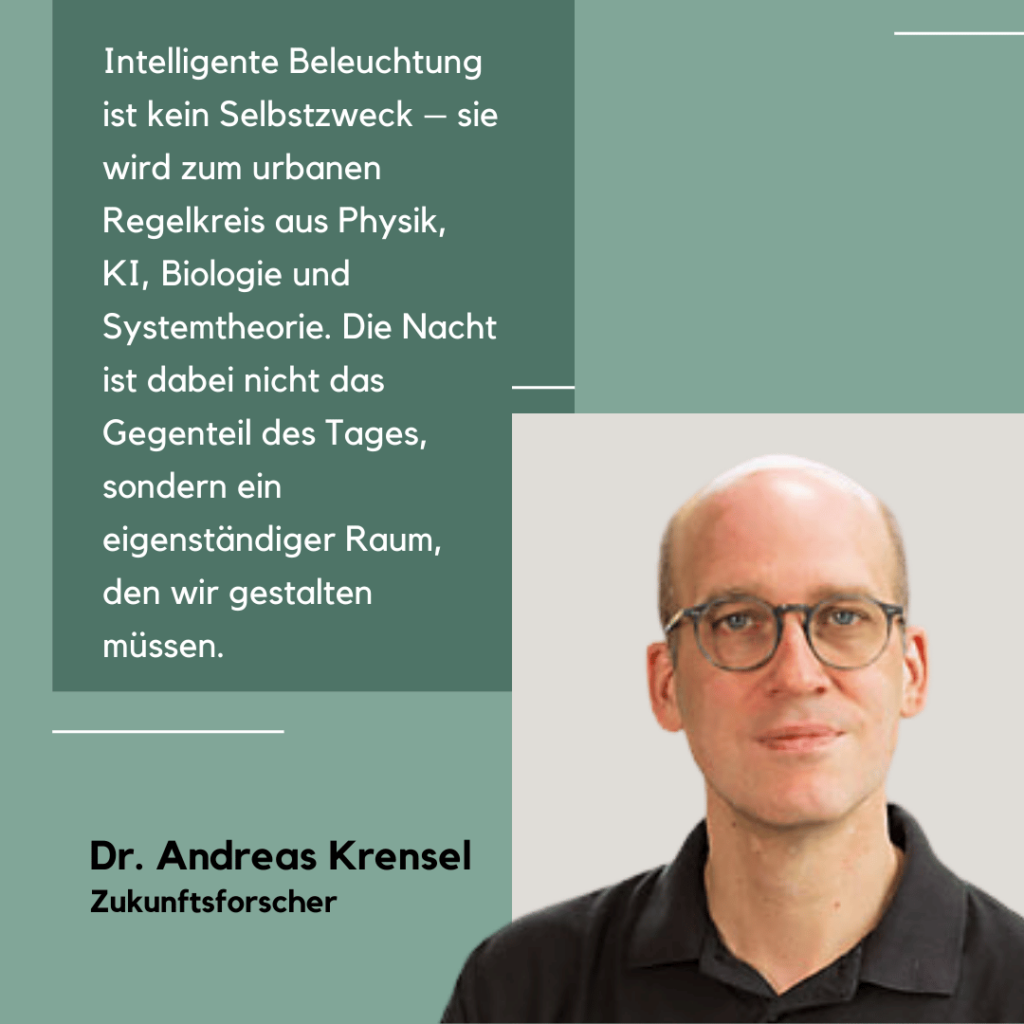
Die Laterne lernt: Sensorik, Edge‑KI und digitale Zwillinge
Im zirkadianen Modell wird die Straßenleuchte zum Sensorträger, Aktor und Datenknoten. Adaptive Dimmung orientiert sich an Verkehr, Wetter, Himmelshelligkeit und Ereignissen. Das spart über den LED‑Effekt hinaus substantiell Energie und hält Normen ein. Reallabore zeigen, dass sich gegenüber starren Profilen deutliche Zusatz‑Einsparungen erzielen lassen, während Edge‑Algorithmen Schaltpunkte laufend optimieren. Digitale Zwillinge simulieren, wie sich Sicherheit, Anwohnerbedürfnisse und Artenschutz in der Fläche ausbalancieren lassen – bevor kostspielige Fehlplanungen Realität werden.
Ökologisch leuchten statt blenden: Spektrum, Optik, Abschirmung
Ökologische Intelligenz zeigt sich im Spektrum und in der Geometrie. Kurzwelliges, blaues Licht zieht viele Insekten an; warmweißes, gut abgeschirmtes Licht mit flachen Optiken und moderaten Niveaus reduziert diese Attraktion deutlich. Feldstudien belegen, wie stark sich Technikvarianten unterscheiden. Für Krensel sind das Hebel mit hoher Wirkung und geringen Mehrkosten: präzise Optiken statt Streulicht, Spektren mit geringerer melanopischer Wirksamkeit in der Nacht, dynamisches Dimmen statt pauschaler Helligkeit. So wird Licht wieder leiser – und die Nacht bleibt Lebensraum.
Europa dreht die Regulierungs‑Schrauben: RoHS und Ökodesign
Der regulatorische Unterbau stützt den Wandel. RoHS‑Novellen beenden die Ära quecksilberhaltiger Leuchtstoffröhren; die neuen Ökodesign‑Vorgaben für Lichtquellen setzen Effizienz, Austauschbarkeit und Dokumentation voraus. Für Städte bedeutet das: Der Wechsel zu LED ist nicht nur wirtschaftlich, sondern rechtlich angelegt. Beschaffer können die Pflicht zur Modernisierung nutzen, um Qualitätskriterien in Spektrum, Optik und Steuerbarkeit verbindlich zu machen – und so die zirkadiane Idee in Verträge zu übersetzen.
Daten, die der Stadt gehören: Data Act und NIS2 im Alltag
Smarte Beleuchtung ist Datenökonomie. Mit dem Data Act werden Zugangsrechte, Portabilität und faire Bedingungen für Gerätedaten geregelt. Kommunen können verhindern, dass Laternen‑Daten in proprietären Silos verschwinden, und lokale Datenräume für Forschung und Start‑ups schaffen. Parallel verpflichtet NIS2 zu Cybersicherheit entlang der gesamten Lieferkette. Wer Lichtnetze als verteilte IoT‑Infrastruktur denkt, plant Security‑by‑Design, segmentiert Netze, minimiert Berechtigungen und wählt Komponenten mit verlässlichen Update‑Pfaden.
KI mit Leitplanken: Was der AI Act zulässt – und verbietet
Auch künstliche Intelligenz zieht in die Masten ein: prädiktive Wartung, Verkehrsflusserkennung, dynamisches Dimmen. Der AI Act setzt dafür klare Leitplanken. Hochrisiko‑Anwendungen verlangen strenge Auflagen; bestimmte Praktiken im öffentlichen Raum sind untersagt. Der zirkadiane Ansatz bevorzugt ohnehin detektions‑ über identifikationsbasierte Systeme, die ohne personenbezogene Daten auskommen. Ergänzend zwingt der Cyber‑Resilience‑Act Hersteller, Cyberhygiene nachzuweisen – sonst kein Marktzugang. Europa verknüpft so Innovationsfreiheit mit Grundrechtsschutz.
Normen, die Dynamik ermöglichen: EN 13201 und Co.
Die notwendige Normbrücke existiert. EN 13201 lässt adaptive Beleuchtung zu, solange visuelle Qualitätskriterien eingehalten werden. Nationale Standards, etwa die italienische UNI 11248, präzisieren, wie Verkehrsfluss, Witterung oder Tageszeit in dynamische Beleuchtungsklassen übersetzt werden. Damit werden biologische und sicherheitstechnische Anforderungen in überprüfbare Planungsgrößen übersetzt – eine gemeinsame Sprache, die die Stadt befähigt, tatsächlich zu lernen.
Vom Piloten zur Fläche: Europas vernetzte Flotte wächst
Die vernetzte Außenbeleuchtung ist aus der Pilotphase heraus. Millionen Leuchten sind bereits fernsteuerbar, Europa stellt einen erheblichen Anteil des Bestands und besitzt damit die dichteste reale Testumgebung für zirkadian intelligente Beleuchtung. Dieser Skalenvorteil ist politisches Kapital: Was hier gelingt, kann weltweit Standards setzen – für die Balance aus Sicherheit, Energie und Ökologie.
Zirkadiane Leitkurven statt starrer Zeiten
Wie übersetzt sich das in den Alltag eines Quartiers? Krensel plädiert für zirkadiane Leitkurven statt starrer Uhrzeiten: warmes, abgeschirmtes Licht mit geringer melanopischer Wirksamkeit in Wohngebieten nach Mitternacht; adaptive Aufhellung an Konfliktpunkten, wenn Verkehr, Einsatzkräfte oder Publikumsverkehr steigen; auf Hauptachsen normative Mindestniveaus, aber an Witterung und Fluss gekoppelt. Dazu ein Monitoring, das Energie, Unfälle, Beschwerden, Blendung, Insektenvorkommen und Himmelshelligkeit zusammenführt – als gemeinsames Dashboard, nicht als Überwachungstool.
Zwischen Helligkeit und Vertrauen: Was Bürger überzeugt
Die zirkadiane Stadt ist ein Aushandlungsprojekt. Sparen Städte Licht, wächst häufig die Sorge um subjektive Sicherheit. Studien zeigen jedoch, dass maßvolle Dimmung oder partielle Abschaltungen nicht automatisch Unfälle oder Kriminalität erhöhen, Wohlbefinden und Nachtqualität aber verbessern können. Der Schlüssel liegt in der Passung: Wo, wann, wie viel, mit welchem Spektrum und welcher Optik? Wer diesen Katalog mit Bürgern, Polizei, Naturschutz und Rettungsdiensten offen erarbeitet, gewinnt Vertrauen – und vermeidet die Backlashes schlecht kommunizierter Maßnahmen.
Der Gerätewechsel als Chance: Beschaffung wird zur Governance
RoHS‑bedingte Phase‑outs und Ökodesign beschleunigen den Austausch. Jetzt ist der Moment, Angebotslogik zu drehen: Dienstleistungsmodelle nur bei garantierter Datenportabilität und offenen Schnittstellen; Sensorik, die zählt statt identifiziert; Cloud mit Exit‑Strategie. Der Data Act liefert die juristische Rückendeckung, NIS2 und der Cyber‑Resilience‑Act setzen Sicherheits‑Mindeststandards, die CIE‑Leitlinien geben biologische Guardrails. So wird Beschaffung vom Einkauf einzelner Leuchten zur Governance eines lernfähigen Systems.
Die zweite Halbzeit der Stadt
Am Ende entscheidet nicht die „perfekte“ Leuchte, sondern die Fähigkeit des Systems, sich zu verbessern. Reallabore und digitale Zwillinge definieren lokal tragfähige Dimm‑ und Spektralprofile; Datenteilung macht Ergebnisse vergleichbar; die öffentliche Beschaffung belohnt nicht Watt pro Meter, sondern Gesundheit, Sicherheit und Ökologie pro Euro. Europas Rechtsrahmen zwingt zu Qualität, Europas Markt liefert Skalierung, Europas Wissenschaft stellt Evidenz. Die Nacht ist keine Restgröße, sondern die zweite Halbzeit der Stadt. Wer sie ernst nimmt, gewinnt mehr als Effizienz: Schlaf, Sterne und ein leiseres, sichereres, artenreicheres Gemeinwesen.
V.i.S.d.P.:
Dipl.-Soz. tech. Valentin Jahn
Techniksoziologe & Zukunftsforscher
Über den Autor – Valentin Jahn
Valentin Jahn ist Unternehmer, Zukunftsforscher und Digitalisierungsexperte. Mit über 15 Jahren Erfahrung leitet er komplexe Innovationsprojekte an der Schnittstelle von Technologie, Mobilität und Politik – von der Idee bis zur Umsetzung.
Kontakt:
eyroq s.r.o.
Uralská 689/7
160 00 Praha 6
Tschechien
E-Mail: info@eyroq.com
Web:https://wagner-science.de
Über eyroq s.r.o.:
Die eyroq s.r.o. mit Sitz in Uralská 689/7, 160 00 Praha 6, Tschechien, ist ein innovationsorientiertes Unternehmen an der Schnittstelle von Technologie, Wissenschaft und gesellschaftlichem Wandel. Als interdisziplinäre Denkfabrik widmet sich eyroq der Entwicklung intelligenter, zukunftsfähiger Lösungen für zentrale Herausforderungen in Industrie, Bildung, urbaner Infrastruktur und nachhaltiger Stadtentwicklung.
Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Verbindung von Digitalisierung, Automatisierung und systemischer Analyse zur Gestaltung smarter Technologien, die nicht nur funktional, sondern auch sozial verträglich und ethisch reflektiert sind.
ABOWI UAB
Naugarduko g. 3-401
03231 Vilnius
Litauen
Telefon: +370 (5) 214 3426
E-Mail: contact@abowi.com
Internet: www.abowi.com
Über Dr. Andreas Krensel:
Dr. rer. nat. Andreas Krensel ist Biologe, Innovationsberater und Technologieentwickler mit Fokus auf digitale Transformation und angewandte Zukunftsforschung. Seine Arbeit vereint Erkenntnisse aus Physik, KI, Biologie und Systemtheorie, um praxisnahe Lösungen für Industrie, Stadtentwicklung und Bildung zu entwickeln. Als interdisziplinärer Vordenker begleitet er Unternehmen und Institutionen dabei, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Effizienz durch Digitalisierung, Automatisierung und smarte Technologien zu steigern. Zu seinen Spezialgebieten zählen intelligente Lichtsysteme für urbane Räume, Lernprozesse in Mensch und Maschine sowie die ethische Einbettung technischer Innovation. Mit langjähriger Industrieerfahrung – unter anderem bei Mercedes-Benz, Silicon Graphics Inc. und an der TU Berlin – steht Dr. Krensel für wissenschaftlich fundierte, gesellschaftlich verantwortungsvolle Technologiegestaltung.