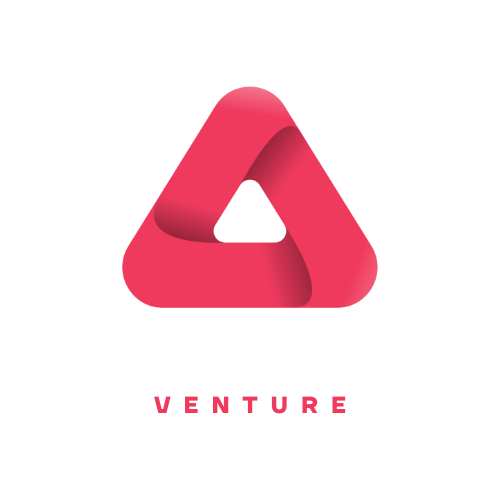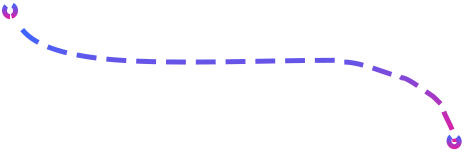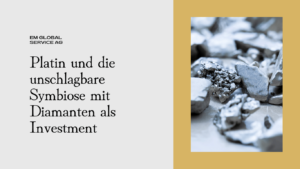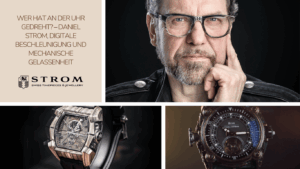Wie Kosten, Rendite und Intransparenz das Vertrauen zerstören – zwischen Sicherheit und Rendite – ein System in der Krise. Wie lange kann die Lebensversicherung noch Vertrauen beanspruchen, wenn Verbraucher Milliarden einzahlen, aber kaum profitieren?
Die Lebensversicherung galt Jahrzehnte als „sicherer Hafen“ der Altersvorsorge. Millionen Deutsche vertrauten ihre Ersparnisse den großen Versicherern an, in der Hoffnung auf Stabilität und eine verlässliche Rente. Doch die Realität im Jahr 2025 sieht ernüchternd aus. Der Kapitalanlagenbestand der Lebensversicherer (ohne Pensionskassen und Pensionsfonds) sank 2024 leicht um 0,7 Prozent, also um 6,8 Milliarden Euro, auf insgesamt 1.019 Milliarden Euro, so die aktuellen Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Zwar gab es im selben Jahr eine Bruttoneuanlage von 128,6 Milliarden Euro – ein Plus von 3,6 Prozent –, doch für Verbraucher bleibt von diesen Milliarden kaum etwas übrig.
Warum also profitieren die Versicherer, während Kunden von hohen Kosten und niedrigen Renditen enttäuscht sind? Dieser Widerspruch ist nicht nur ein wirtschaftliches Problem, sondern wirft auch fundamentale juristische Fragen auf. Experten wie Sven Enger, ehemaliger Vorstand mehrerer Versicherungsunternehmen und heute Geschäftsführer der auxinum GmbH, sowie Prof. Dr. Philipp Schade, unabhängiger Aktuar, erklären, warum das System im Kern krankt und wie dringend eine Reform nötig ist.
Das Dilemma der Rendite – Zahlen, die ernüchtern
Die Nettoverzinsung der Kapitalanlagen erreichte 2024 einen Wert von 2,37 Prozent, im Vorjahr lag sie bei 2,27 Prozent. Das klingt zunächst nach einer Verbesserung – doch in Zeiten von Inflation reicht eine solche Verzinsung kaum aus, um die Kaufkraft des Geldes zu erhalten. Die laufende Durchschnittsverzinsung lag 2024 bei 2,43 Prozent und damit nur knapp über der Nettoverzinsung. Zum Vergleich: In den 1990er-Jahren waren Verzinsungen von über 4 Prozent die Regel.
Prof. Dr. Schade bringt es aus Sicht des Aktuariats auf den Punkt: „Die Mathematik ist unbestechlich. Was an Kosten, Garantiezinsen und Verwaltung abgeführt wird, kann nicht gleichzeitig Rendite für den Verbraucher sein.“ Mit anderen Worten: Selbst bei steigenden Kapitalanlagen profitieren in erster Linie die Versicherer – der Kunde bleibt auf der Strecke. Der Grund liegt darin, dass eine Nettoverzinsung durch die Höhe der veräußerten Kapitalanlagen bestimmt wird. Der Versicherer wird aber nur genau so viele Kapitalanlagen auflösen, wie gerade notwendig sind, nachdem er die eingenommenen Beiträge des Jahres verwendet hat, um die Versicherungsleistungen zu bezahlen, die Gewinnabführung an die Konzernmutter oder die Kapitalrücklage zu gewährleisten und darüber hinaus die sonstigen bilanziellen Aufwände (wie bspw. das Anwachsen der sog. Deckungsrückstellung als reiner Bilanzposten) zu bedienen. Es könnten natürlich weitaus mehr Kapitalanlagen veräußert werden, was dann einen Überschuss für die Versicherungsverträge bedeuten würde. Aber warum sollte man das tun? Die Höhe der Nettoverzinsung wird daher immer durch den Versicherer selbst festgelegt. Vergessen wird überdies, dass die Kapitalanlagen in der Bilanz zu Anschaffungskosten bilanziert sind, d. h. die Bilanz gibt nicht den sog. “fair value” wieder, im Gegensatz zu angelsächsischen Versicherern. Die tatsächliche Entwicklung der Kapitalanlagen ist daher gar nicht bilanziell direkt einsehbar.

Sicherheit versus Rendite – ein unauflösbarer Widerspruch?
Die Versicherungsbranche argumentiert seit Jahren mit dem Thema Sicherheit. Durch die Regulierung unter Solvency II sind Versicherer gezwungen, große Teile der Kapitalanlagen in festverzinsliche Anleihen und sichere Assets zu investieren. Das sichert die Erfüllbarkeit von Ansprüchen – aber zulasten der Rendite.
Sven Enger warnt: „Sicherheit und Rendite dürfen nicht in einen Topf geworfen werden. Wer Sicherheit verspricht, darf nicht gleichzeitig eine hohe Rendite suggerieren – das ist Augenwischerei.“
Juristisch betrachtet ist die Frage brisant: Täuscht die Branche ihre Kunden mit Werbeaussagen, die ein Gleichgewicht von Sicherheit und Rendite versprechen, das faktisch nicht existiert? Solche Versprechen könnten in den Bereich der irreführenden Werbung (§ 5 UWG) oder gar der Falschberatung (§ 280 BGB) fallen.
Verbraucher in der Falle – hohe Kosten, wenig Transparenz
Noch schwerer wiegt für viele Kunden die Kostenstruktur. Verwaltungskosten von 2–3 Prozentpunkten (nicht zu verwechseln mit zwei Prozent auf irgendeine Bezugsbasis, das wäre schön, denn wir sind eher bei durchschnittlich ca. 12-15% Kostenbelastung auf den laufenden Beitrag) jährlich sind keine Seltenheit. In einem Umfeld, in dem die Nettoverzinsung bei knapp 2,4 Prozent liegt, frisst die Kostenlast praktisch die gesamte Rendite auf.
Die Realität bestätigt sich auch in der Riester-Krise: Jeder vierte Vertrag – insgesamt über fünf Millionen von 20 Millionen – wurde bereits gekündigt. Allein von Januar bis August 2025 kamen weitere 220.000 Kündigungen hinzu. Verbraucher sind frustriert, weil sie kaum noch Chancen auf eine positive Nettorendite sehen.
Prof. Dr. Schade erklärt: „Wenn man die (intransparenten) Kosten mit der real erzielten Rendite vergleicht, sieht man sofort, dass für viele Kunden am Ende weniger übrigbleibt als eingezahlt wurde. Die Zahlen lügen nicht.“
Juristische Brille – Rechte der Verbraucher bei Enttäuschung
Viele Versicherte stehen irgendwann vor der drängenden Frage: Kann ich aus meinem Vertrag überhaupt wieder heraus? Die Antwort lautet: Ja – aber nur unter bestimmten rechtlichen Voraussetzungen. In der Praxis haben sich dabei mehrere Wege herauskristallisiert, die für Verbraucher von erheblicher Bedeutung sein können. So können etwa fehlerhafte Widerrufsbelehrungen ein Einfallstor für eine Rückabwicklung eröffnen. Juristisch spricht man hier von der ungerechtfertigten Bereicherung nach § 812 BGB, weil der Versicherer Leistungen behalten hat, für die keine wirksame vertragliche Grundlage besteht. In solchen Fällen können Verbraucher nicht nur ihre gezahlten Beiträge zurückverlangen, sondern häufig auch eine Nutzungsentschädigung für den Zeitraum, in dem das Geld beim Versicherer gebunden war.
Darüber hinaus spielt die Qualität der Beratung eine zentrale Rolle. Wer beim Vertragsabschluss durch Vermittler unzureichend oder gar falsch beraten wurde, kann Schadenersatzansprüche geltend machen. Grundlage hierfür sind die im Versicherungsvertragsgesetz (VVG) verankerten Beratungspflichten, die klar vorschreiben, dass Kunden über alle relevanten Kosten, Risiken und Alternativen umfassend aufzuklären sind. Gerade hier zeigt die Praxis, dass Versicherungsnehmer oftmals nur unvollständig informiert werden – sei es über die hohen Abschlusskosten, über lange Laufzeiten oder über die eingeschränkten Renditechancen klassischer Lebens- und Rentenversicherungen.
Die Rechtsprechung hat in den vergangenen Jahren eine Reihe von verbraucherfreundlichen Urteilen hervorgebracht. Immer wieder obsiegen Versicherte vor Gericht, weil ihnen wesentliche Informationen bewusst verschwiegen oder verharmlost wurden. In diesen Fällen sehen die Gerichte nicht nur eine Verletzung von Aufklärungspflichten, sondern teilweise auch eine Verletzung der guten Sitten oder des Grundsatzes von Treu und Glauben. Das ist mehr als ein juristisches Detail – es berührt den Kern des Verbraucherschutzes und stellt die Frage, ob das klassische Lebensversicherungsmodell in seiner heutigen Form überhaupt noch mit diesem Leitgedanken vereinbar ist. Ist ein Produkt, das über Jahrzehnte hinweg eher dem Kapitalinteresse der Gesellschaften als den Bedürfnissen der Versicherten dient, noch tragfähig? Oder bedarf es grundlegender Reformen, die die Interessen der Verbraucher stärker in den Mittelpunkt rücken?

Ökonomische Dimension – Milliardenvermögen, aber für wen?
Während die Verbraucher kaum profitieren, sieht es bei den Versicherern anders aus. Rund zwei Drittel der Kapitalanlagen fließen in die Privatwirtschaft, etwa über Unternehmensanleihen, Immobilien oder Pfandbriefe. Die Eigenmittelquote (also das Eigenkapital ins Verhältnis gesetzt zu den jährlichen Beitragseinnahmen) der Branche stieg 2024 auf 141,6 Prozent (Vorjahr: 140,1 Prozent) – ein Wert, der die Stabilität der Versicherer beweist. [BITTE ZAHLEN NOCHMAL PRÜFEN – denn eigentlich ist das Eigenkapital ganz gering, ich bezweifle daher diese Angabe]
Doch Sven Enger sieht die Schieflage: „Das System stabilisiert die Bilanzen der Unternehmen, nicht die Altersvorsorge der Verbraucher.“ Für den einzelnen Versicherten bleibt die Frage: Wessen Interessen stehen hier im Mittelpunkt – die der Kunden oder die der Gesellschaften?
Zukunftsfragen – Reform oder Abwicklung?
Die Welle der Kündigungen bei Riester-Verträgen zeigt unmissverständlich, dass Verbraucher die Geduld mit diesem Modell verloren haben. Millionen Menschen sehen kaum noch Chancen auf eine angemessene Altersvorsorge über Produkte, die einst als zukunftssicher galten. Vor diesem Hintergrund versucht die Bundesregierung ab 2026 mit der sogenannten Frühstartrente einen Neustart. Die Idee: Jedes Kind zwischen sechs und 18 Jahren soll monatlich zehn Euro in ein staatlich gefördertes Depot eingezahlt bekommen, das bis zur Rente anwächst. Auf dem Papier klingt das nach einer charmanten Lösung, um frühzeitig den Grundstein für eine Altersvorsorge zu legen. Doch die Realität sieht anders aus – viele Fachleute zweifeln, ob dieses Modell tatsächlich geeignet ist, die systemischen Schwächen der privaten Altersvorsorge zu beheben.
Finanzexperten von Finanztip haben dazu jüngst veröffentlicht, dass die Frühstartrente in ihrer jetzigen Form kaum mehr sei als ein symbolischer Schritt. Der Betrag von zehn Euro pro Monat könne weder die wachsende Rentenlücke schließen noch ernsthaft die Herausforderungen ausgleichen, die durch Inflation, steigende Lebenshaltungskosten und anhaltend niedrige Renditen bestehen. Finanztip verweist zudem auf die strukturellen Fehler, die schon das Riester-Modell zum Scheitern gebracht haben: zu hohe Kosten, intransparente Vertragsbedingungen und eine komplizierte Förderstruktur, die für viele Verbraucher eher eine Hürde als eine Hilfe darstellt. Entscheidend sei nicht allein die Frage, ob der Staat Geld zur Verfügung stellt, sondern ob dieses Geld in klar regulierte, kostengünstige und renditestarke Produkte fließt, die tatsächlich das leisten, was sie versprechen.
Juristisch bleibt dabei offen, ob die Bundesregierung gewillt ist, aus dem Scheitern der Riester-Rente die notwendigen Konsequenzen zu ziehen. Reicht ein staatlicher Zuschuss aus, wenn die strukturellen Mängel unangetastet bleiben? Oder droht auch die Frühstartrente, in wenigen Jahren als gescheitertes Experiment in die Geschichte einzugehen, weil Verbraucher weiterhin in einem Nebel aus hohen Kosten, geringen Renditen und komplizierten Regeln zurückgelassen werden? Genau hier liegt die eigentliche Bewährungsprobe für die Politik – und für die Glaubwürdigkeit der Altersvorsorge insgesamt.
Fazit – ein System im Umbruch
Die Lebensversicherung steht an einem Scheideweg. Für Juristen und Ökonomen ist klar: Das Modell, das jahrzehntelang als Garant für Sicherheit galt, ist in seiner bisherigen Form nicht mehr tragfähig. Verbraucher fühlen sich enttäuscht, viele Verträge werden gekündigt, und die Schieflage zwischen Milliardenvermögen aufseiten der Versicherer und geringen Renditen für die Kunden ist offensichtlich.
Prof. Dr. Schade: „Die Mathematik ist eindeutig – ohne Reformen werden Verbraucher immer die Verlierer sein.“ Sven Enger ergänzt: „Wir müssen Altersvorsorge neu denken – weg von intransparenten Produkten, hin zu klaren, fairen Strukturen.“
Das bedeutet: Nur wenn Politik, Aufsichtsbehörden, Juristen und Verbraucher gemeinsam an einem Strang ziehen, kann das Vertrauen zurückgewonnen werden. Sicherheit, Rendite und Transparenz dürfen nicht länger ein Widerspruch sein – sondern müssen die drei Säulen einer fairen Altersvorsorge bilden.
Autor:
Dr. Thomas Schulte, Rechtsanwalt
Kontakt
Rechtsanwalt Dr. Thomas Schulte
E-Mail: law@meet-an-expert.com
Pressekontakt
ABOWI UAB
Naugarduko g. 3-401
03231 Vilnius
Litauen
Telefon: +370 (5) 214 3426
E-Mail: contact@abowi.com
Internet: www.abowi.com