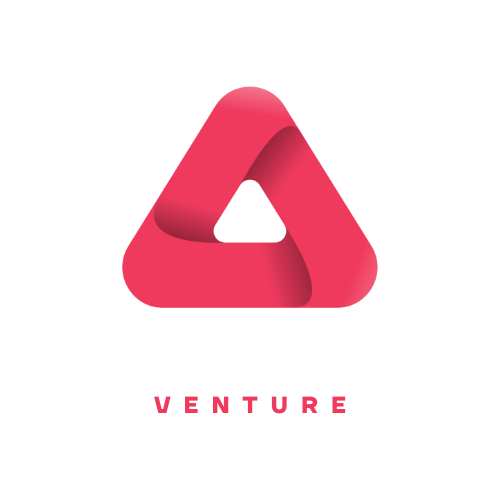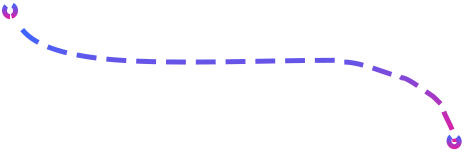Provinzial-Abspaltung: Was die BaFin-Entscheidung wirklich bedeutet zum Versicherungsaufsichtsrecht und zur Strukturtransformation. Wie ein Milliarden-Transfer zwischen zwei Traditionsversicherern neue Fragen nach Transparenz, Haftung und Aufsicht aufwirft – und warum die Verfügung vom 15. August 2025 ein Signal an die gesamte Branche sendet.
Mit ihrer Entscheidung vom 15. August 2025 hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ein deutliches Zeichen gesetzt: Die Genehmigung eines Vertrags über die Abspaltung eines Teilvermögens zwischen der Provinzial Versicherung Aktiengesellschaft in Düsseldorf und der Provinzial Next Aktiengesellschaft in Münster ist mehr als ein unternehmensinterner Umbau – sie ist ein Präzedenzfall für die Anwendung des § 14 Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) in einer Zeit, in der Versicherungsgruppen ihre Strukturen zunehmend dynamisch anpassen müssen.
Nach Angaben aus dem Jahresbericht der Provinzial-Gruppe 2024 verwaltet der Konzern ein Anlagevermögen von über 50 Milliarden Euro und betreut mehr als 12 Millionen Versicherungsverträge. Allein diese Zahlen verdeutlichen, dass jede Veränderung der Vermögensstruktur – insbesondere bei konzerninternen Übertragungen – aufsichtsrechtlich von erheblicher Tragweite ist. Die BaFin musste prüfen, ob die Abspaltung die Finanzkraft, Solvabilität und Risikoverteilung der beteiligten Unternehmen beeinträchtigt und ob die Interessen der Versicherten, die oberste Leitlinie des Aufsichtsrechts, gewahrt bleiben.
Im Kern geht es damit um eine juristisch wie ökonomisch hochrelevante Frage: Wie lässt sich unternehmerische Freiheit mit dem Schutz der Versichertengemeinschaft in Einklang bringen?
Die Entscheidung zeigt, dass die Aufsicht bereit ist, komplexe Strukturmaßnahmen zuzulassen, wenn sie klar begründet, transparent ausgestaltet und risikoadäquat begleitet werden. Doch sie wirft zugleich neue Fragen auf – etwa zur Kontrolle konzerninterner Transaktionen, zu Haftungsverschiebungen innerhalb von Versicherungsgruppen und zur Reichweite der Zustimmungspflicht nach § 14 VAG.
Für Dr. Thomas Schulte, Berliner Rechtsanwalt mit Schwerpunkt im Versicherungs-, Finanz- und Kapitalmarktrecht, ist diese Verfügung ein juristischer Lackmustest: „Die BaFin zeigt mit dieser Genehmigung, dass sie bereit ist, neue Wege zu gehen – aber sie macht auch deutlich, dass rechtliche Sorgfalt und Transparenz keine Verhandlungsmasse sind. Jede Umstrukturierung im Versicherungswesen bleibt eine Frage des Vertrauens – und das Vertrauen der Versicherten ist das höchste Gut.“
Aus Sicht von Sven Enger, ehemaliger Vorstand mehrerer Versicherer und heute Geschäftsführer der auxinum GmbH, liegt die wahre Bewährungsprobe solcher Abspaltungen weniger im juristischen „Ob“, sondern im operativen „Wie“. „Eine BaFin-Genehmigung nach § 14 VAG ist die Eintrittskarte, nicht das Zielband“, so Enger. „Erst Datenmigration, Bestandsführung, IT-Schnittstellen, Rückversicherungsanbindungen und die glasklare Kundenkommunikation entscheiden, ob die Strukturmaßnahme für Versicherte wertschonend abläuft – oder Vertrauen verbrennt.“
Enger betont, dass konzerninterne Transfers leicht unterschätzt werden: Rückkaufswerte, Überschussbeteiligung, Leistungsbearbeitung, Beschwerdemanagement – all dies müsse nahtlos funktionieren, während Produktversprechen, Kostenlogik und Servicelevel unverändert eingehalten werden. „Rechtlich sauber ist notwendig; betriebswirtschaftlich belastbar und kundenverständlich ist zwingend“, sagt er. Juristisch fraglich sei insbesondere, wie Haftungs- und Governance-Linien nach der Abspaltung tatsächlich gelebt werden: Wer trägt im Ernstfall das Risiko? Wie werden Solvabilitäts- und Risikokonzentrationen über den Konzern hinweg transparent? Und wie wird kommunikativ sichergestellt, dass Versicherte ohne Nachteil gestellt sind?
Mit Blick auf die Branche ordnet Enger die Provinzial-Transaktion als Signal ein: „Die Zins- und Demografiewende erzwingt sauber segmentierte, effizient geführte Plattformen. Abspaltungen können dafür ein sinnvolles Instrument sein – sofern sie kundenorientiert gestaltet, aufsichtsrechtlich lückenlos dokumentiert und operativ fehlerfrei umgesetzt werden.“ Seine Praxisempfehlung: frühzeitige Migrations-Dry-Runs, harte KPI-Steuerung (Dunkelverarbeitung, Bearbeitungszeiten, Fehlerquoten, Storno), ex ante geprüfte Rechts- und Kommunikationsleitfäden sowie transparente Informationspakete für Vermittler und Versicherte. „Am Ende zählt nur, ob der Kunde nach der Abspaltung mindestens genauso gut gestellt ist. Daran misst sich nicht nur der Erfolg der Maßnahme – daran misst sich die Glaubwürdigkeit der gesamten Branche.“

Rechtsgrundlage der BaFin-Genehmigung: § 14 VAG im Fokus
Im Kern dieser aufsichtsrechtlichen Maßnahme steht die gesetzlich normierte Genehmigungspflicht der BaFin gemäß § 14 VAG. Diese Vorschrift regelt, dass Verträge über Abspaltungen von Versicherungsunternehmen der ausdrücklichen Zustimmung der Aufsichtsbehörde bedürfen. Der Gesetzgeber schützt hiermit nicht nur die Interessen der Versicherten, sondern auch die Stabilität des Versicherungssektors insgesamt.
Wörtlich heißt es in § 14 Abs. 1 VAG:
„Ein Versicherungsunternehmen darf eine Verschmelzung, eine Spaltung oder eine Vermögensübertragung nur mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde durchführen. Die Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn die Interessen der Versicherten gewahrt sind.“
Die hier vorliegende Abspaltung eines Teils des Vermögens stellt eine „Spaltung“ im Sinne des Umwandlungsgesetzes dar, welche nach § 123 UmwG in Verbindung mit dem VAG durch die BaFin zu prüfen ist. Die Genehmigung der Behörde dient der Vermeidung nachteiliger Folgen für Versicherte, aber auch für Kapitalmärkte und Gläubiger.
Wirtschaftliche und regulatorische Notwendigkeit des Vorgangs – ein Balanceakt zwischen Innovation und Aufsicht
Hinter komplexen Strukturmaßnahmen wie der Abspaltung zwischen Provinzial Versicherung AG und Provinzial Next AG verbirgt sich weit mehr als eine buchhalterische Reorganisation. Sie sind Ausdruck eines strategischen Anpassungsprozesses in einer Branche, die zwischen Regulierungsdruck, Marktdynamik und technologischem Wandel neu balancieren muss. Ziel solcher Schritte ist es, operative Flexibilität zu schaffen – etwa durch die Auslagerung bestimmter Geschäftsbereiche, die gezieltere Produktentwicklung oder die Schaffung agiler Tochtergesellschaften, die schneller auf Kundenbedürfnisse und Marktentwicklungen reagieren können.
In diesem Kontext spricht Sven Enger, ehemaliger Vorstand mehrerer Versicherer und heute Geschäftsführer der auxinum GmbH, von einem notwendigen „Erneuerungsimpuls aus der Struktur heraus“. „Die Versicherungsbranche“, so Enger, müsse sich „von trägen Konzernstrukturen lösen, um in einer digitalisierten, renditearmen Welt noch effizient agieren zu können“. Gerade die Provinzial-Gruppe, die sich mit einem Anlagevolumen von über 50 Milliarden Euro zu den Schwergewichten des deutschen Versicherungsmarkts zählt, habe erkannt, dass Organisationsstruktur, Kapitalsteuerung und Produkterfolg untrennbar miteinander verbunden sind.
Aus regulatorischer Sicht sind solche Restrukturierungen jedoch kein Freifahrtschein für wirtschaftliche Kreativität. Die BaFin prüft streng nach den Maßgaben des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG), insbesondere hinsichtlich der Kapitalausstattung, der Solvabilitätsquoten und der versicherungstechnischen Rückstellungen. Jede Verschiebung von Vermögenswerten oder Risiken muss aufsichtsrechtlich transparent dokumentiert und ökonomisch begründbar sein. Enger bringt es auf den Punkt: „Wer Kapital verlagert, verlagert Verantwortung. Deshalb müssen Governance, Controlling und Compliance nach einer Abspaltung neu justiert werden – sonst bleibt die Struktur ein leeres Versprechen.“
Die BaFin agiert dabei als multidisziplinäres Gremium – mit Aktuaren, Wirtschaftsprüfern und Juristen, die jeden einzelnen Aspekt bewerten. Es geht nicht nur um Zahlen, sondern um Systemstabilität und Verbraucherschutz. Dr. Thomas Schulte betont: „Solche Abspaltungen sind mehr als Verwaltungsakte – sie sind Regulierung in der Praxis, bei der versicherungsaufsichtsrechtliche Theorie auf ökonomische Realität trifft.“
Tatsächlich zeigt der Vorgang exemplarisch, wie eng wirtschaftliche Strategie und juristische Präzision miteinander verflochten sind. Während die Unternehmen operative Effizienz und Zukunftsfähigkeit anstreben, wacht die Aufsicht darüber, dass Solidität, Transparenz und Rechtstreue nicht auf der Strecke bleiben. In dieser Gratwanderung zwischen Innovation und Regulierung liegt der eigentliche Kern moderner Versicherungsaufsicht – und genau dort, so Enger, „entscheidet sich, ob die Branche die Kurve Richtung Zukunft schafft oder sich in ihrer eigenen Komplexität verliert.“
Haftungsfragen und Gläubigerschutz
Ein zentrales Thema in Verfahren dieser Art ist die Sicherstellung, dass keine Nachteile für Gläubiger entstehen. Auch hier greift § 14 VAG ein, stellt jedoch Anforderungen in Kombination mit §§ 133 ff. UmwG. Insbesondere Art. 135 UmwG enthält Gläubigerschutzvorschriften, die in dieser Genehmigungspraxis berücksichtigt wurden.
Juristen kennen die Komplexität solcher Verfahren sehr genau. „Die Abwendung der gesamthaften Haftung kann nur durch einen vollständigen Nachweis gelingen, dass alle Verpflichtungen auf das richtige Unternehmen übergehen. Hier sind exakte rechtliche Analysen unumgänglich“, so Dr. Schulte.
Die BaFin analysiert in diesem Zusammenhang unter anderem auch die wirtschaftliche Tragfähigkeit des neuen Unternehmens, im konkreten Fall der Provinzial Next AG. Diese muss zeigen, dass sie die übernommenen Verpflichtungen dauerhaft und rechtskonform erfüllen kann.
Strukturveränderung zwischen Marktlogik und Aufsicht – ein Lehrstück in Regulierung und Anpassungsfähigkeit
Die Gründung oder Ausgliederung neuer Versicherungsgesellschaften gehört längst zu den zentralen Werkzeugen moderner Unternehmensführung – sie ist Ausdruck ökonomischer Anpassungsfähigkeit in einem Markt, der sich in rasantem Wandel befindet. Versicherer stehen heute unter einem historisch beispiellosen Anpassungsdruck: Digitalisierung, Klimarisiken, verändertes Kundenverhalten und volatile Kapitalmärkte fordern nicht nur betriebswirtschaftliche, sondern auch aufsichtsrechtliche Innovationskraft.
Das „enge Korsett“ der europäischen Solvabilitätsvorgaben gemäß Solvency II bildet dabei den verbindlichen Rahmen. Nach den jüngsten EIOPA-Berichten (2024) liegt die durchschnittliche Solvabilitätsquote europäischer Versicherer bei 252 %, deutsche Anbieter bewegen sich mit rund 280 % sogar über dem europäischen Mittelwert. Das belegt: Stabilität ist vorhanden – aber sie hat ihren Preis. Jedes neue Tochterunternehmen, jede Kapitalabspaltung muss mit Blick auf Eigenmittelunterlegung, Risikotragfähigkeit und Stresstests neu kalibriert werden.
Hier zeigt sich das juristische Spannungsfeld: Wie weit darf unternehmerische Freiheit gehen, ohne das Fundament der Solidität zu gefährden? Die Aufsicht verlangt, dass jede Strukturentscheidung nachhaltig und belastbar ist – nicht nur im Jahresabschluss, sondern im Krisenfall. Eine Abspaltung wie die der Provinzial Versicherung AG zur Provinzial Next AG ist somit kein bloßer Managementakt, sondern ein aufsichtsrechtliches Hochpräzisionsmanöver, das ökonomische Vision und juristische Sorgfalt in Einklang bringen muss.
Die Provinzial-Gruppe, mit einem verwalteten Anlagevermögen von über 50 Milliarden Euro und rund 12 Millionen Versicherungsverträgen, steht beispielhaft für den Transformationsdruck der Branche. Mit der Gründung der Provinzial Next AG verfolgt sie ein klares Ziel: eine Plattform zu schaffen, die digitalisierte Versicherungsabschlüsse, automatisierte Schadenprozesse und datenbasierte Produktentwicklung ermöglicht – kurz: eine moderne, anpassungsfähige Struktur, die Kundenorientierung und Effizienz vereint.
Sven Enger sieht darin ein strategisches Musterbeispiel: „Die Versicherungsbranche kann sich keinen Stillstand leisten. Wer heute nicht ausgliedert, konsolidiert oder digitalisiert, riskiert morgen die Wettbewerbsfähigkeit. Doch solche Schritte sind riskant – rechtlich wie reputativ. Ein klarer Governance-Rahmen, begleitet durch die Aufsicht, ist entscheidend, um Vertrauen zu sichern.“
Die BaFin bestätigt mit ihrer Genehmigung der Abspaltung, dass die Maßnahme rechtlich und ökonomisch tragfähig ist. Gleichzeitig signalisiert sie, dass Aufsicht nicht als Bremse, sondern als Qualitätsfilter fungiert. In ihrer Entscheidung spiegelt sich ein neues Verständnis regulatorischer Kooperation: Die Behörde überprüft nicht nur Risiken, sondern bewertet auch unternehmerische Tragfähigkeit und Prozessqualität.
Damit berührt der Fall eine Grundfrage des modernen Versicherungsrechts: Wie viel Freiheit verträgt Regulierung – und wie viel Regulierung braucht Freiheit?
Während Unternehmen bestrebt sind, ihre Geschäftsmodelle effizient und digital aufzustellen, liegt es an der Aufsicht und den beratenden Juristen, das fragile Gleichgewicht zwischen wirtschaftlicher Eigenverantwortung und systemischer Stabilität zu wahren.

Bedeutung für Anleger und Versicherte – Vertrauen entsteht nur durch Erneuerung
Aus Sicht der Kapitalanleger und Versicherten ist die BaFin-Genehmigung weit mehr als ein formaler Verwaltungsakt – sie ist ein Signal des Vertrauens. Mit ihrer Zustimmung stellt sich die Aufsichtsbehörde sichtbar schützend vor die Interessen der Versicherten, deren Kapital und Zukunftsvorsorge von solchen Strukturentscheidungen unmittelbar betroffen sind. Die strengen Vorgaben, die die BaFin im Rahmen solcher Verfahren stellt, gewährleisten, dass jede Umstrukturierung geordnet, rechnerisch solide und juristisch tragfähig erfolgt. Sie verhindern, dass Verbraucher oder institutionelle Anleger nachträglich unter Fehlkonstruktionen oder riskanten Unternehmensentscheidungen leiden.
Doch gerade in dieser Stabilität liegt auch eine Herausforderung. Sven Enger weist darauf hin, dass die Versicherungswirtschaft nicht nur Regulierung erfüllen, sondern neue Perspektiven für finanzielle Sicherheit schaffen müsse. „Die Branche muss begreifen, dass Vertrauen nicht durch Paragraphen, sondern durch spürbaren Mehrwert entsteht“, erklärt Enger. „Wir stehen an einem Wendepunkt: Versicherte erwarten keine klassischen Produkte mehr, sondern verlässliche Lebensbegleitung in einer Welt permanenter Unsicherheit.“ Dr. Thomas Schulte ergänzt: „Die Zukunft des Versicherungsgedankens liegt in der Verbindung von Rechtssicherheit, Transparenz und digitaler Kompetenz. Wer heute noch auf alte Modelle vertraut, riskiert, dass ganze Generationen das Vertrauen in die private Vorsorge verlieren.“
Die BaFin-Genehmigung ist daher nicht nur ein regulatorisches „Go“, sondern auch eine Aufforderung an die Branche, alte Denkmuster zu hinterfragen. Jahrzehntelang dominierten statische Produkte, hohe Verwaltungskosten und intransparente Renditemodelle. Diese Strukturen werden in einer zunehmend selbstbestimmten und datengetriebenen Finanzwelt nicht überleben. Versicherungsunternehmen, die auch künftig relevant bleiben wollen, müssen bereit sein, neue Wege zu gehen – etwa durch digitale Vertriebsmodelle, personalisierte Tarife, hybride Garantiekonzepte und verstärkte finanzielle Bildung ihrer Kunden.
In einem ersten Schritt bedeutet das, alte Überzeugungen abzulegen: die Vorstellung, Sicherheit lasse sich nur durch Komplexität erzeugen; dass Regulierung automatisch Fortschritt bremse; oder dass Kunden passiv und loyal bleiben, selbst wenn Renditen sinken. Die moderne Versicherungsökonomie verlangt das Gegenteil – Transparenz, Einfachheit und Vertrauen.
Für Anleger und Versicherte eröffnet sich dadurch eine neue Perspektive: weg vom passiven Vertrauen in Institutionen, hin zur aktiven Mitgestaltung ihrer finanziellen Zukunft. Die BaFin trägt dazu bei, indem sie klare Regeln und transparente Prozesse vorgibt – und damit den rechtlichen Rahmen schafft, in dem Innovation und Verbraucherschutz kein Widerspruch mehr sind.
Oder, wie es Enger und Schulte gemeinsam formulieren: „Der Schutz der Versicherten hat oberste Priorität – doch er beginnt nicht erst im Krisenfall, sondern bei der Art, wie die Branche Zukunft denkt. Versicherer müssen den Mut haben, sich neu zu erfinden – erst dann wird aus Regulierung auch wirklich Sicherheit.“
Was bedeutet dies für den Versicherungsmarkt allgemein? – Aufbruch in eine Ära fairer und transparenter Absicherung
Treffen Unternehmen der Versicherungswirtschaft heute Entscheidungen über Abspaltungen, Fusionen oder Neugründungen, geht es längst nicht mehr um interne Prozessoptimierung oder Bilanzkosmetik. Solche Maßnahmen sind Ausdruck einer tiefgreifenden Transformation der gesamten Branche – eines Wandels, der über Strukturen und Zahlen hinausgeht. In Wahrheit steht das Versicherungssystem selbst auf dem Prüfstand. Die klassischen Modelle von Sicherheit und Vorsorge, die jahrzehntelang auf festen Garantiezinsen, standardisierten Policen und passiven Kundenbeziehungen beruhten, stoßen zunehmend an ihre Grenzen.
Der Markt befindet sich in einer Phase ökonomischer und gesellschaftlicher Neuausrichtung. Neue Unternehmen drängen mit frischen Konzepten und kundenorientierten Geschäftsmodellen in den Wettbewerb. Sie setzen auf digitale Prozesse, transparente Kostenstrukturen und individuelle Risikoanalysen, die nicht nur den Schutz, sondern auch das Vertrauen der Verbraucher in den Mittelpunkt rücken. Künstliche Intelligenz, Klimarisiken und alternative Kapitalanlagen sind dabei nicht nur technologische Schlagworte, sondern reale Triebkräfte eines Systemwandels, der die Art und Weise, wie wir Sicherheit verstehen, grundlegend verändert.
Sven Enger betont: „Die Branche braucht eine Neugründung ihres Selbstverständnisses. Versicherungen dürfen nicht länger Produkte verkaufen, sondern müssen Lösungen für Lebensrisiken bieten, die fair, transparent und anpassungsfähig sind. Der Kunde muss das Gefühl haben, dass seine Sicherheit nicht von Konzerninteressen, sondern von nachvollziehbaren Werten getragen wird.“
Genau hier zeigt sich die gesellschaftliche Dimension dieser Entwicklung: Versicherungen werden künftig nicht nur für den Schadensfall da sein, sondern als aktive Partner in der Lebens- und Finanzplanung fungieren müssen. Eine Neuschaffung von Absicherungen, die fair und zukunftsorientiert sind, erfordert eine Umstrukturierung auf mehreren Ebenen – von der Produktgestaltung über die Kapitalanlagepolitik bis hin zur Kommunikationskultur. Kunden verlangen heute nachvollziehbare Informationen, einfache Vertragsmodelle, klare Renditeperspektiven und die Gewissheit, dass ihre Beiträge nachhaltig und ethisch verantwortbar angelegt werden.
Der regulatorische Rahmen, den das Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG), das Umwandlungsgesetz (UmwG) sowie die europäischen Solvabilitätsvorgaben (Solvency II) setzen, schafft die architektonische Grundlage für diesen Wandel. Diese Regeln sind kein Selbstzweck, sondern das juristische Rückgrat einer fairen Marktentwicklung. Sie sorgen dafür, dass neue Unternehmensmodelle nachvollziehbar, kontrolliert und im Sinne der Versicherten entstehen – und dass ökonomischer Fortschritt nicht auf Kosten der Sicherheit geht.
Dr. Thomas Schulte fasst es prägnant zusammen: „Regulierung soll nicht lähmen, sondern schützen. Die Zukunft des Versicherungsmarktes entscheidet sich daran, ob wir es schaffen, Stabilität und Innovation zu verbinden – in einer Weise, die den Menschen wieder in den Mittelpunkt rückt.“
So könnte aus der aktuellen Welle von Umstrukturierungen keine Bedrohung, sondern eine Chance für Erneuerung entstehen: eine Branche, die aus starren Modellen ausbricht, transparente und faire Absicherungssysteme schafft und den Versicherten eine neue Perspektive gibt – nicht als Kostenfaktor, sondern als Teil eines verantwortungsvollen Finanzökosystems, das Sicherheit neu denkt und Zukunft möglich macht.
Autor:
Dr. Thomas Schulte, Rechtsanwalt
Kontakt
Rechtsanwalt Dr. Thomas Schulte
E-Mail: law@meet-an-expert.com
Pressekontakt
ABOWI UAB
Naugarduko g. 3-401
03231 Vilnius
Litauen
Telefon: +370 (5) 214 3426
E-Mail: contact@abowi.com
Internet: www.abowi.com