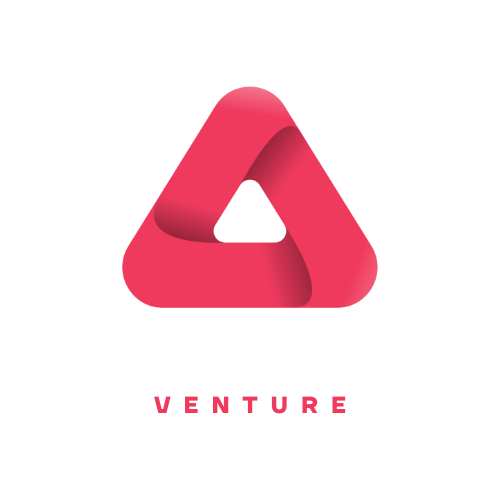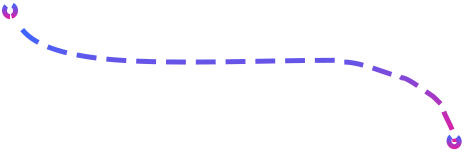FINMA im Zentrum Europas: Regulatorische Macht, internationale Verantwortung und die Frage nach der Zukunft. Wenn die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht spricht, hört nicht nur die Schweiz zu. Sie ist längst zu einem der einflussreichsten Taktgeber in der europäischen Finanzarchitektur geworden – doch wie stabil ist diese Rolle in Zeiten von Umbruch und Führungsvakuum?
Der Schweizer Finanzplatz war über Jahrzehnte Symbol für Solidität, Diskretion und Zuverlässigkeit. Doch in einer Welt, in der geopolitische Spannungen, digitale Innovationen und globale Krisen die Spielregeln der Finanzmärkte neu schreiben, wird auch die Schweiz zunehmend zum Prüfstein für Regulierungskraft und Anpassungsfähigkeit. Hier tritt die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) als Schlüsselfigur auf die Bühne: Sie wacht nicht nur über Banken und Versicherer innerhalb der Landesgrenzen, sondern ihre Entscheidungen strahlen weit über die Alpen hinaus und prägen den gesamteuropäischen Finanzmarkt.
Gerade deshalb hat der angekündigte Rücktritt von Thomas Hirschi, Leiter des Geschäftsbereichs Banken, zum 31. August 2025 eine Sprengkraft, die über Personalpolitik hinausgeht. Welche Signalwirkung entfaltet ein solcher Abgang in einer Phase, in der Vertrauen, Transparenz und Krisenfestigkeit mehr denn je gefragt sind? Welche Herausforderungen ergeben sich, wenn eine Aufsichtsbehörde, die für viele als Bollwerk gegen systemische Risiken gilt, vor einer Neujustierung ihrer Führungsstrukturen steht? Und nicht zuletzt: Ist die FINMA bereit, ihre Rolle als europäischer Stabilitätsanker auch in Zukunft mit derselben Entschlossenheit zu behaupten?
Als Rechtsanwalt mit langjähriger Spezialisierung im Banken- und Kapitalmarktrecht blickt Dr. Thomas Schulte aus Berlin gemeinsam mit dem Wirtschafts- und Finanzexperten Dr. Peter Riedi aus dem Fürstentum Liechtenstein auf dieses Ereignis – und eröffnet eine kritische Diskussion über die juristische, ökonomische und politische Tragweite eines Wechsels, der weit mehr bedeutet als einen bloßen Stabwechsel an der Spitze.
Ein profilierter Experte verlässt die Bühne
Thomas Hirschi prägte über viele Jahre hinweg das regulatorische Fundament des Schweizer Banken- und Vermögensverwaltungssektors, einem Bereich, der nicht erst seit der Krise rund um die Credit Suisse (CS) unter besonderer Beobachtung steht. Seine jahrzehntelange Tätigkeit innerhalb der FINMA, darunter auch als stellvertretender Direktor ad interim, belegt seine Expertise und sein tiefgreifendes Verständnis für die institutionellen und operativen Voraussetzungen eines stabilen Finanzsystems.
Als Leiter des Geschäftsbereichs Asset Management ab 2020 verfolgte Hirschi einen klaren regulatorischen Kurs hin zu mehr Transparenz und Professionalität. Insbesondere die neue Bewilligungspflicht für unabhängige Vermögensverwalter, die mit Inkrafttreten des FIDLEG (Finanzdienstleistungsgesetz) und des FINIG (Finanzinstitutsgesetz) eingeführt wurde, war ein zentraler Punkt auf seiner Agenda. Unter seiner Verantwortung wurden die strukturellen Voraussetzungen geschaffen, um diese komplexen Verfahren effizient und rechtssicher durchzuführen. Dies ist ein Paradebeispiel für die Herausforderung modernen Behördenhandelns im Spektrum zwischen Finanztechnik und juristischer Verbandsregulierung.
Gleichzeitig verdient Hirschis Engagement Dank und Anerkennung: Er hat die Verantwortung übernommen, schwierige Transformationsprozesse in einer Zeit fundamentaler Umbrüche zu steuern. Damit leistete er nicht nur einen Beitrag zur unmittelbaren Stabilisierung, sondern schuf auch die Grundlagen für die künftige Transformation des Schweizer Finanzplatzes. Denn ohne eine starke, kompetent geführte Aufsicht wäre ein stabiler und sicherer Wirtschaftsmarktplatz kaum denkbar.
Dr. Peter Riedi betont in diesem Zusammenhang: „Die Führungsposition von Thomas Hirschi war weit mehr als eine administrative Rolle. Sie war Ausdruck der Fähigkeit, Vertrauen zu schaffen, Veränderungsprozesse einzuleiten und Stabilität zu gewährleisten – Eigenschaften, die in Zeiten globaler Unsicherheit über den Erfolg oder Misserfolg ganzer Finanzsysteme entscheiden können.“
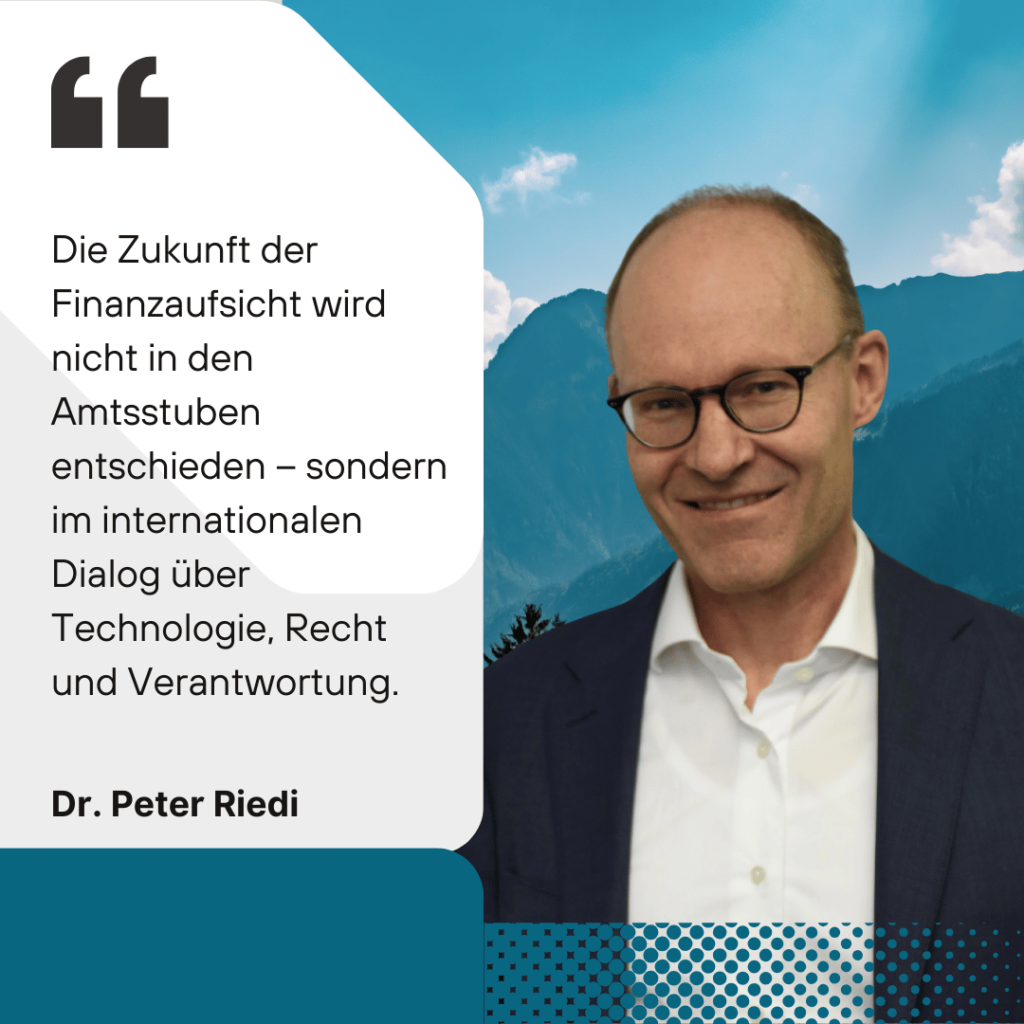
Reaktionen aus der Institutionslandschaft
Der scheidende Direktor Thomas Hirschi erhielt dabei nicht nur Rückendeckung aus dem Kollegenkreis, sondern auch umfangreiche Anerkennung seitens der obersten Leitung. So erklärte Stefan Walter, aktueller Direktor der FINMA:
„Im Namen der ganzen Geschäftsleitung danke ich Thomas Hirschi herzlich für seinen grossen Einsatz in seinen fünf Jahren als Leiter der Bankenaufsicht und des Geschäftsbereiches Asset Management bei der FINMA.“
Auch die Verwaltungsratspräsidentin Marlene Amstad würdigte sein Wirken und stellte insbesondere seinen Beitrag zur Bewältigung der multikausalen Krise rund um die Credit Suisse heraus:
„Besonders erwähnenswert ist sein Beitrag zur Bewältigung der CS-Krise und seine Zeit als stellvertretender Direktor ad interim.“
Diese offiziellen Statements zeigen mit der gebotenen Deutlichkeit an, wie wesentlich die Rolle von Herrn Hirschi innerhalb der FINMA war.
Hier zeigt sich eine seltene Kombination: Fachexpertise gepaart mit Führungskompetenz im wohl am stärksten regulierten Wirtschaftsbereich Europas – der Finanzwirtschaft. Gerade dieser Sektor, geprägt von hochkomplexen Regelwerken wie Basel III, Solvency II, MiFID II, FIDLEG oder FINIG, erfordert Persönlichkeiten, die nicht nur die juristischen Feinheiten verstehen, sondern auch die Fähigkeit besitzen, daraus handhabbare Strategien für die Praxis zu entwickeln. Es reicht längst nicht mehr, Paragrafen zu beherrschen – notwendig ist ein tiefes ökonomisches Verständnis, ein Gespür für Marktmechanismen und die Kompetenz, divergierende Interessen von Banken, Anlegern, Politik und Aufsicht miteinander in Einklang zu bringen.
Denn die Finanzwirtschaft ist nicht nur ein regulierter Wirtschaftsbereich, sie ist das Nervensystem der gesamten europäischen Ökonomie. Ein Führungsfehler, ein Aufsichtsversagen oder eine zu spät erkannte Marktverwerfung kann nicht nur einzelne Institute ins Wanken bringen, sondern systemische Kettenreaktionen auslösen – wie die Krise um die Credit Suisse eindringlich vor Augen geführt hat. In diesem Umfeld entscheidet die seltene Kombination aus Fachwissen und Führungsstärke über Stabilität oder Instabilität, über Vertrauen oder Vertrauensverlust.
Gerade deshalb ist es so bedeutsam, wenn Persönlichkeiten wie Thomas Hirschi ihre regulatorische Expertise mit klarer Führung verbinden. Sie schaffen die notwendige Balance zwischen strikter Regelkonformität und pragmatischer Handlungsfähigkeit – und damit die Grundlage dafür, dass Europas am stärksten regulierter Markt zugleich innovationsfähig und krisenfest bleibt.
Das Aufsichtsrecht als deutsche Perspektive auf das schweizerische Modell
Aus deutscher juristischer Sicht stellt sich nun die Frage: Welche Lehren lassen sich aus Thomas Hirschis Wirken für die hiesige Finanzaufsicht ziehen? Zunächst ist in Erinnerung zu rufen, dass auch in Deutschland die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nach § 6 Kreditwesengesetz (KWG) weitreichende Kompetenzen zur Überwachung der Einhaltung von aufsichtsrechtlichen Vorschriften besitzt. Überdies folgt aus Art. 114 AEUV der Rahmen für eine einheitliche europäische Finanzaufsicht, in welcher die Funktionen nationaler Aufsichtsbehörden zunehmend im Spannungsverhältnis zu supranationalen Gremien wie der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) stehen.
Ein zentrales Element, das aus dem schweizerischen Modell beachtenswert erscheint, ist die Verbindung fachlicher Spezialisierung mit längerfristiger Perspektive im Amtsverständnis. Die Kontinuität, mit der Persönlichkeiten wie Thomas Hirschi in Aufsichtsfunktionen wirken, stellt einen Mehrwert dar, der nicht überschätzt werden darf.
Ein häufig zitiertes Prinzip im Aufsichtsrecht lautet: „Aufsicht erfordert Kenntnis, Distanz und Konsequenz.“ Thomas Hirschi verkörperte dieses Prinzip exemplarisch. Insbesondere seine Einbindung in die Bewältigung der CS-Krise – mit ihren weitreichenden Implikationen für den Vertrauensaspekt im Bankensektor – macht seine Arbeit vorbildlich für jede europäische Aufsichtsstruktur.
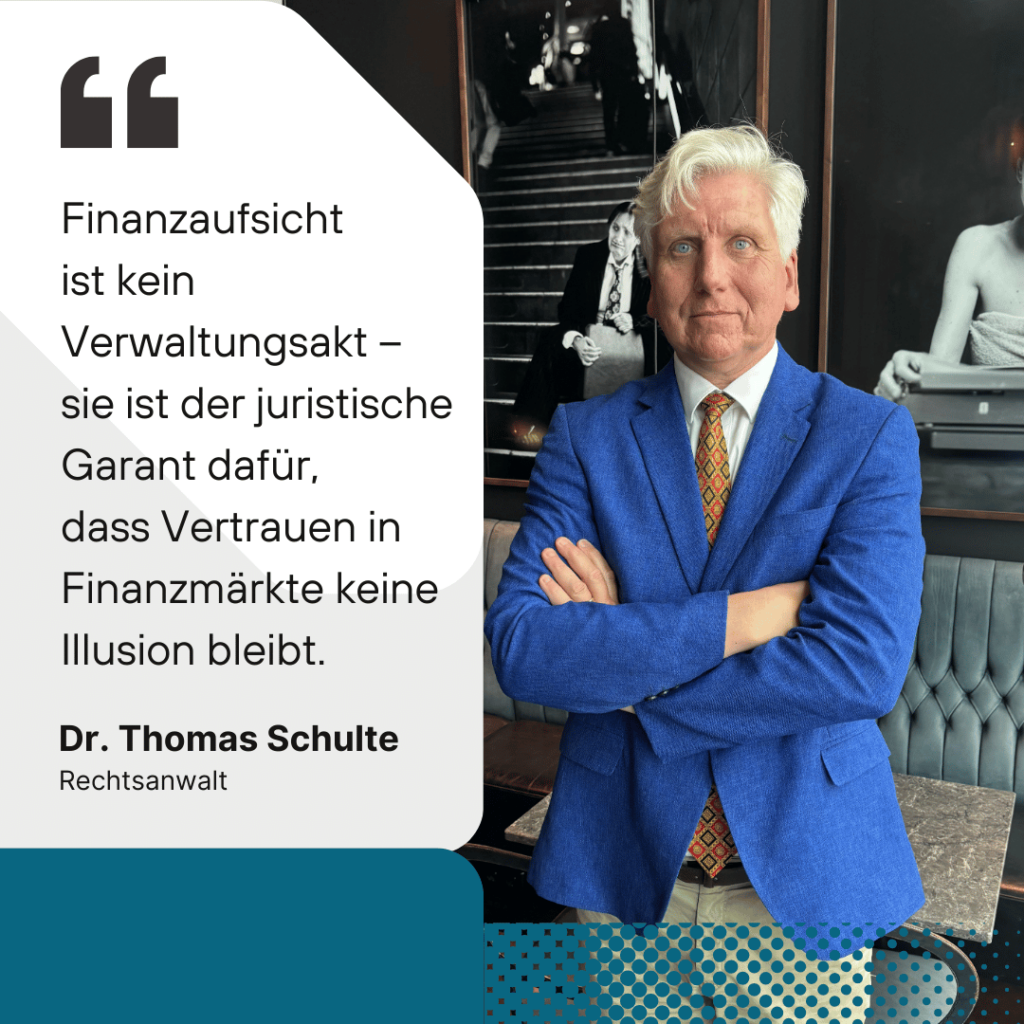
Credit-Suisse-Krise als Lackmustest für systemische Stabilität
Ohne zu sehr in juristische Fachdetails abzudriften, sei auch ein Blick auf die regulatorischen Konsequenzen dieser Krise erlaubt. Die Abwicklung und Kapitalausstattung systemrelevanter Institute wirft gewichtige Fragen zu den Kompetenzen von Aufsichtsbehörden auf. Im deutschen Kontext sind dies insbesondere §§ 49 ff. Sanierungs- und Abwicklungsgesetz (SAG), die die Umsetzung von EU-Richtlinien in nationales Recht darstellen.
In der Schweiz trat Thomas Hirschi als Krisenmanager auf – nicht im Sinne eines staatlichen Intervenisten, sondern als Garant struktureller Resilienz. Eine Fähigkeit, die in Zeiten zunehmender geo- und makroökonomischer Instabilität unverzichtbar erscheint. Dabei ging es nicht nur um schnelle Entscheidungen, sondern um dauerhafte Präventionsarbeit. Eine große Herausforderung besteht stets darin, zwischen Aufsicht und Intervention ein juristisch tragfähiges Gleichgewicht zu finden – ein Punkt, den auch die stetige Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts in Deutschland betont.
Ausblick auf die Zukunft der Finanzaufsicht
Der personelle Wechsel fällt in eine Zeit, in der sich Bankenaufsicht neu erfinden muss. Künstliche Intelligenz, Blockchain-Technologien und dezentralisierte Finanzmärkte (DeFi) drängen zu immer neuen Regulierungsansätzen. Es bedarf Persönlichkeiten mit dem notwendigen juristischen Rüstzeug und strategischer Weitsicht, um dieser Entwicklung konstruktiv zu begegnen.
Aus Sicht der digitalwirtschaftlichen Transformationsprozesse bleibt eine zentrale Herausforderung bestehen: die normative Integration technologischer Innovationen in ein bestehendes Rechtssystem. Hierzu ist das Zusammenspiel von erfahrenen Juristen und aufgeschlossenen Behördenleitern unerlässlich. Thomas Hirschi lieferte ein Musterbeispiel dafür, wie dieses Zusammenspiel gelingen kann.
Doch der Blick nach vorn wirft dringende Fragen auf: Wie gelingt es, in einer Zeit der digitalen Revolution eine Aufsicht zu etablieren, die grenzüberschreitend funktioniert und europäische Standards nicht nur anpasst, sondern aktiv mitgestaltet? Hier braucht es nicht nur Kontinuität, sondern eine Aufsicht, die neue Technologien versteht und gleichzeitig die Stabilität der Märkte schützt. Dr. Peter Riedi betont in diesem Zusammenhang: „Die Zukunft der Finanzaufsicht entscheidet sich nicht mehr allein in nationalen Behördenstuben. Es geht um die Fähigkeit, Wissen über Grenzen hinweg zu teilen und Synergien im europäischen Raum zu schaffen. Nur wenn wir den digitalen Wandel gemeinsam gestalten, können wir die Finanzmärkte Europas stabil, sicher und wettbewerbsfähig halten. Die FINMA wird dabei ein Schlüsselakteur sein – nicht nur als Schweizer Aufsichtsorgan, sondern als europäische Impulsgeberin im globalen Kontext.“ Dr. Thomas Schulte ergänzt aus juristischer Sicht: „Das bestehende Rechtssystem steht unter enormem Druck, neue Technologien wie KI, Blockchain oder DeFi normativ zu integrieren, ohne die Rechtssicherheit zu gefährden. Hierbei zeigt sich: Die Qualität einer Finanzaufsicht bemisst sich künftig daran, ob sie die Brücke schlagen kann zwischen den rechtlichen Anforderungen und der praktischen Innovationskraft der Märkte. Dazu bedarf es Führungspersönlichkeiten, die nicht nur Paragrafen anwenden, sondern strategische Visionen entwickeln und im europäischen Dialog verankern.“
So wird deutlich: Der personelle Wechsel markiert nicht nur das Ende einer Ära, sondern ist auch ein Prüfstein für die Fähigkeit Europas, in Zeiten digitalwirtschaftlicher Transformation eine starke, lernfähige und international vernetzte Finanzaufsicht zu etablieren – zum Schutz der Anleger, zur Stabilisierung der Märkte und zur Stärkung des Finanzplatzes Europa insgesamt.
Bleibt die Frage nach der Nachfolge
Noch ist unklar, wer im Sommer 2025 in die großen Fußstapfen treten wird. Entscheidend wird sein, wie viel Kontinuität die FINMA sich leisten kann und will. Der Handlungsspielraum für leitende Aufsichtsbeamte wird in Zukunft durch politische, wirtschaftliche und technologische Umstände noch stärker eingeengt sein. Umso wichtiger ist ein klares rechtliches Fundament, auf dem Entscheidungen beruhen können. Hieran mitzuwirken, ist nicht nur Aufgabe der jeweiligen Behörden, sondern auch der beratenden Juristen und Rechtsanwälte, die die Entwicklungen begleiten und einordnen.
Fazit: Finanzaufsicht in Europa zwischen Neubewertung und Zukunftschance
Die Rolle des Staates in der Finanzmarktaufsicht erfährt mit dem Ausscheiden einer Persönlichkeit wie Thomas Hirschi eine Neubewertung. Gerade im Hinblick auf die fortschreitende Verrechtlichung der Finanzwelt wird die Expertise erfahrener Leitungskräfte ebenso bedeutsam wie die ständige Evaluierung rechtlicher Rahmenbedingungen. Wie § 6 Absatz 1 KWG normiert, obliegt es der Aufsicht, „ein den Risiken angemessenes Verhalten der beaufsichtigten Institute zu fördern“. Solche normative Leitlinien gewinnen durch personelle Veränderungen neue Aktualität: Jeder Führungswechsel wird zu einem Lackmustest für die Stabilität des Systems.
Die Finanzaufsicht ist längst nicht mehr nur ein nationaler Wächter über Banken und Versicherer, sie ist ein integraler Bestandteil der europäischen Stabilitätsarchitektur. Zahlen belegen diese Bedeutung: Allein der europäische Bankensektor verwaltet ein Vermögen von über 24 Billionen Euro (EZB, 2024) – ein Volumen, das fast doppelt so hoch ist wie das Bruttoinlandsprodukt der gesamten EU. Schon kleine regulatorische Fehlentscheidungen können also systemische Kettenreaktionen auslösen. Umgekehrt zeigt die Erfahrung der Finanzkrise 2008, dass entschlossenes Eingreifen Milliardenverluste abwenden kann – damals flossen weltweit über 1,7 Billionen US-Dollar an staatlichen Stützungsmaßnahmen in den Bankensektor, um eine globale Rezession einzudämmen.
In Zeiten von Künstlicher Intelligenz, Blockchain und DeFi wächst die Bedeutung internationaler Kooperation. Schon heute überwachen europäische Aufsichtsbehörden wie die EBA (European Banking Authority) oder die ESMA (European Securities and Markets Authority) gemeinsam mit nationalen Behörden mehr als 6.000 Kreditinstitute und 30.000 Finanzdienstleister europaweit. Die FINMA als schweizerische Institution nimmt dabei eine besondere Rolle ein: Obwohl die Schweiz nicht Mitglied der EU ist, hat sie mit ihren Regularien vielfach Vorbildcharakter – sei es in der Vermögensverwaltung oder beim Umgang mit systemrelevanten Banken.
Juristisch betrachtet bedeutet das: Die Finanzaufsichten stehen vor der doppelten Aufgabe, bestehende Regeln flexibel an technologische Entwicklungen anzupassen und zugleich die Rechtssicherheit nicht zu gefährden. Wirtschaftlich betrachtet gilt: Ein stabiler, verlässlicher Finanzplatz ist Grundvoraussetzung für Investitionen, Wachstum und Vertrauen – nicht nur in Europa, sondern im globalen Wettbewerb.
Der Rücktritt Hirschis markiert insofern keinen Bruch, sondern vielmehr einen Neubeginn. Er macht sichtbar, dass Finanzaufsicht nicht an Personen gebunden bleibt, sondern an Strukturen, die lernfähig, dynamisch und vernetzt sein müssen. Europa hat die Chance, aus diesem Moment einen Aufbruch zu formen: hin zu einer Finanzaufsicht, die nicht nur auf Krisen reagiert, sondern aktiv Maßstäbe setzt – für Sicherheit, Globalität und Innovationsfähigkeit.
Das Fazit lautet deshalb hoffnungsvoll: Die Zukunft der Finanzaufsicht in Europa liegt in der intelligenten Balance zwischen Recht und Wirtschaft, zwischen Stabilität und Wandel, zwischen nationaler Souveränität und globaler Verantwortung. Wenn es gelingt, diese Balance zu halten, können die Finanzmärkte Europas nicht nur sicherer, sondern auch attraktiver und stärker werden – ein stabiler Anker in einer unruhigen Weltwirtschaft.
Autor: Dr. Thomas Schulte, Rechtsanwalt
Dr. Thomas Schulte ist seit 1995 als Rechtsanwalt in Berlin tätig – erfahren, durchsetzungsstark und spezialisiert auf die rechtlichen Herausforderungen der digitalen Gesellschaft. Seine Schwerpunkte liegen im Verbraucherschutz, Internetrecht, Reputationsrecht und Wettbewerbsrecht. Mit seiner Kanzlei vertritt er Mandanten bundesweit, oft digital, schnell und zielgerichtet – per E-Mail, Telefon oder Videokonferenz. Besonders im Reputationsrecht gilt Dr. Schulte als Pionier: Wenn der gute Ruf bedroht ist, steht er für juristische Klarheit, Schutz und strategische Verteidigung. Als Fachautor und Prozessanwalt bringt er komplexe Sachverhalte verständlich auf den Punkt und verbindet juristische Expertise mit unternehmerischem Denken. Wer rechtliche Sicherheit im digitalen Zeitalter sucht, findet in ihm einen engagierten und zuverlässigen Partner.