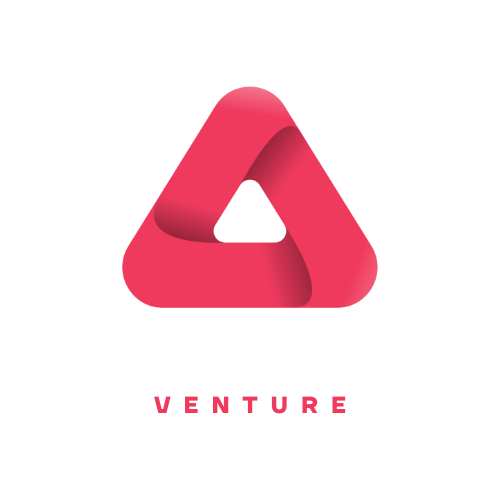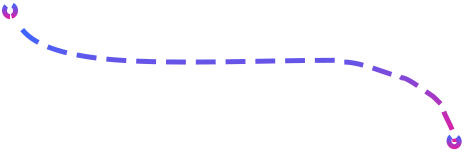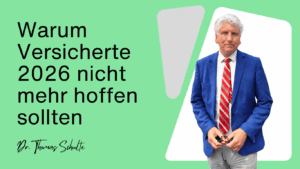Vom Schutz für Hinterbliebene zur Renditemaschine: Warum wir neu denken müssen, was eine gute Versicherung ausmacht – und wer sie wirklich verdient.
Versicherungen – sie sollen schützen, was uns am wertvollsten ist: unsere Existenz, unsere Familie, unsere Zukunft. Seit Jahrhunderten beruht das Prinzip auf Solidarität: Wer heute zahlt, hilft damit dem, der morgen in Not gerät. Die ältesten Modelle wie die „Witwenkasse“ oder die Seemannskasse des Mittelalters dienten vordergründig einem Ziel – den Hinterbliebenen Sicherheit zu geben, wenn der Ernährer verstarb. Doch wie viel ist von dieser Idee im heutigen Versicherungssystem geblieben?
Was wir heute erleben, ist eine Branche, die sich zunehmend von ihrem Gründungsversprechen entfernt hat. Statt gemeinschaftlichem Risikoausgleich dominieren überkalkulierte Tarife, undurchsichtige Rückstellungen und eine Fülle an Zusatzbausteinen, deren tatsächlicher Nutzen oft unklar bleibt. So zeigt eine Analyse der Verbraucherzentrale NRW: In klassischen Lebensversicherungen verlieren Kunden im Schnitt bis zu 30 Prozent ihrer eingezahlten Beiträge an Abschluss- und Verwaltungskosten. Und auch bei der Berufsunfähigkeitsversicherung bleibt vieles im Ungefähren – von versteckten Risikoüberschüssen hin zu einseitig kürzbaren Garantien (§ 314 VAG).
Doch was macht heute eigentlich eine „gute“ Versicherung aus? Reicht es, die Police in der Schublade zu wissen – oder braucht es ein radikales Umdenken im System? Wie viel Schutz steckt tatsächlich in den versprochenen Sicherheiten? Und dürfen wir es hinnehmen, dass Millionen Bürger Jahr für Jahr zahlen, ohne zu wissen, ob ihre Versicherung im Ernstfall überhaupt greift?
Verlorenes Vertrauen, neue Verantwortung: Was eine gute Versicherung heute wirklich leisten muss
Versicherungen waren einst Ausdruck menschlicher Fürsorge. Sie entstanden aus dem Bedürfnis, Angehörige zu schützen – etwa wenn der Ernährer durch Krankheit, Unfall oder Tod wegfiel. Die „Witwenkassen“ der Handwerker im 17. Jahrhundert oder die ersten Lebensversicherungsmodelle im England der Frühindustrialisierung folgten einem klaren Prinzip: gemeinsames Risiko tragen, um individuelles Leid abzufedern. Doch was als solidarisches System begann, hat sich vielerorts in ein intransparentes und provisionsgetriebenes Marktmodell verwandelt – mit tiefgreifenden Folgen für Vertrauen, Fairness und finanzielle Sicherheit der Verbraucher.
Heute umfasst die deutsche Versicherungswirtschaft über 460 Unternehmen mit mehr als 430 Milliarden Euro Beitragseinnahmen pro Jahr (Stand: GDV, 2024). Allein im Bereich der Lebensversicherung wurden 2023 rund 86 Milliarden Euro Beiträge eingenommen – davon entfallen etwa ein Drittel auf kapitalbildende Produkte, die kaum noch reale Rendite erwirtschaften. Gleichzeitig werden laut BaFin regelmäßig über 100 Millionen Verträge verwaltet – viele davon mit versteckten Kosten und schwer nachvollziehbaren Garantien.
Im Bereich der Berufsunfähigkeitsversicherungen zeigen aktuelle Analysen: Nur etwa 20 bis 30 Prozent der Versicherten erhalten im Leistungsfall überhaupt die zugesagte BU-Rente. Der Rest scheitert an Ablehnungen, Nachweispflichten oder wirtschaftlicher Überforderung – trotz teils jahrzehntelanger Beitragszahlungen. Hinzu kommt ein massiver Vertriebsapparat: In Deutschland sind derzeit über 197.000 Versicherungsvermittler registriert, von denen der Großteil provisionsabhängig arbeitet – was den Verkaufsdruck und Interessenkonflikt zusätzlich verschärft.
Die ursprüngliche Idee, durch Versicherung gemeinschaftlich Sicherheit zu schaffen, wurde zunehmend verdrängt durch Produkte, die mehr auf Kapitalbindung und Vertriebserfolg als auf echten Risikoschutz ausgerichtet sind. Statt Fürsorge dominiert Rendite, statt Solidarität die Frage: Wie viel lässt sich aus dem Kunden noch herausholen? Damit steht die Branche heute an einem Scheideweg – und mit ihr das Vertrauen einer ganzen Gesellschaft.
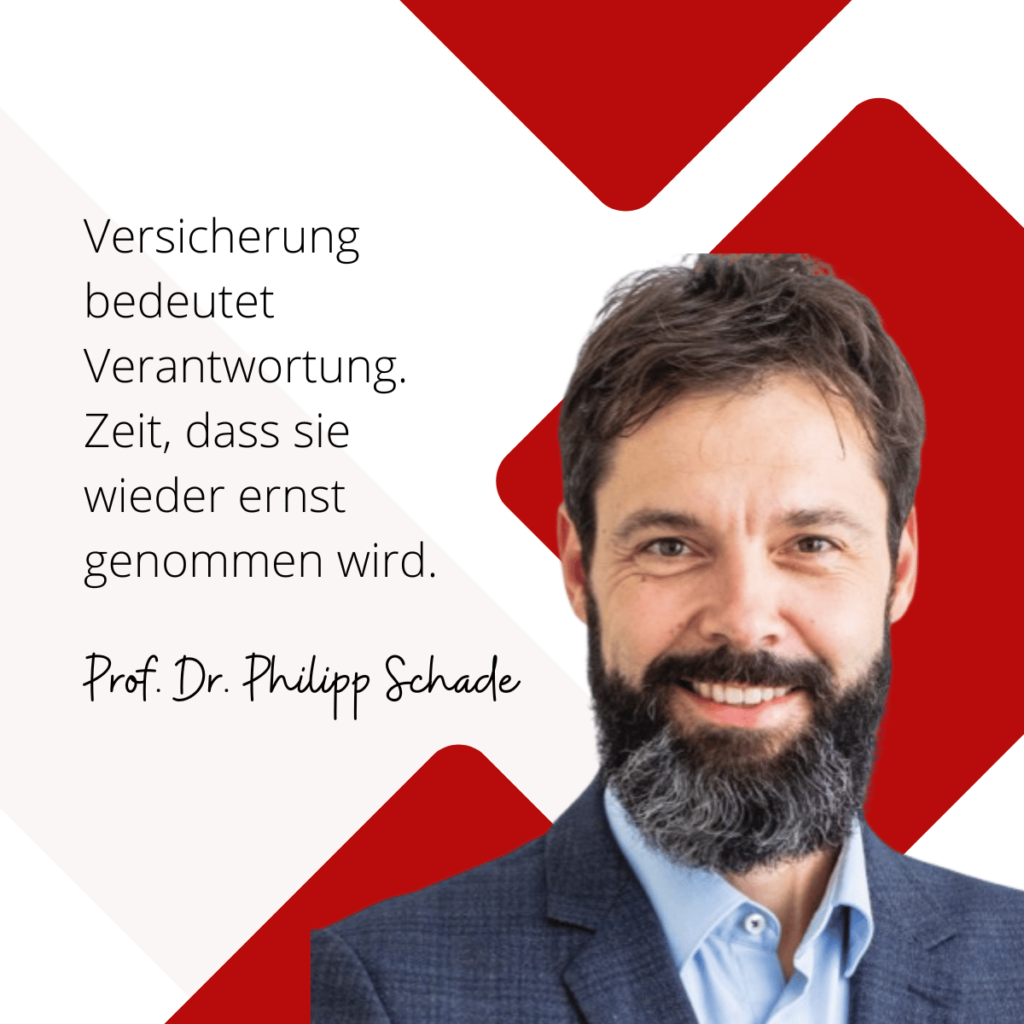
Wenn Versicherungen Rendite versprechen – und Schutz zur Nebensache wird
Heute sind Versicherungen häufig nicht mehr nur Risikopuffer, sondern Finanzprodukte mit hochkomplexen Kalkulationsmodellen. Besonders deutlich wird das im Bereich der Berufsunfähigkeitsversicherung (BU): ein Produkt, das theoretisch Sicherheit bei existenzieller Bedrohung geben soll – praktisch aber mit undurchsichtigen Kosten, überhöhten Prämien und zweifelhaften Garantien arbeitet.
Nehmen wir das Beispiel von Anna, 31 Jahre alt, examinierte Pflegekraft in einer geriatrischen Klinik. Ihr Beruf ist körperlich fordernd, psychisch belastend – und gesellschaftlich unverzichtbar. Sie verdient etwa 2.800 Euro brutto im Monat und weiß: Sollte sie durch einen Bandscheibenvorfall, ein Burnout oder eine chronische Erkrankung ausfallen, würde das nicht nur ihre berufliche, sondern auch ihre finanzielle Existenz gefährden. Um sich abzusichern, entscheidet sie sich für eine Berufsunfähigkeitsversicherung mit einer monatlichen Rente von 1.200 Euro – genug, um im Notfall ihre laufenden Kosten zu decken.
Doch die Kosten für diesen Schutz sind hoch: Rund 122,32 Euro monatlich soll sie zahlen, so der Durchschnittswert nach aktuellen BU-Tarifen. Und das, obwohl eine realitätsnahe Risikokalkulation – unter Berücksichtigung der tatsächlichen Eintrittswahrscheinlichkeiten und einer durchschnittlichen Leistungsdauer von nur drei bis sechs Jahren – einen Beitrag von etwa 60 Euro für fair und ausreichend hielte. Doppelt so viel Beitrag wie nötig, Monat für Monat, Jahr für Jahr.
Wohin fließt das Geld? Nur zu einem kleinen Teil in den eigentlichen Risikoschutz. Der Rest verteilt sich auf Verwaltungskosten, Rückstellungen – und vor allem auf Abschlussprovisionen, die bei einem solchen Vertrag nicht selten bei 1.200 bis 2.000 Euro liegen. Das bedeutet: Schon im ersten Jahr wird ein erheblicher Teil von Annas Beitrag nicht für ihre Absicherung verwendet, sondern für den Vertrieb.
Für jemanden wie Anna, die sich mit Empathie, körperlichem Einsatz und großem Verantwortungsgefühl um andere kümmert, ist das ein bitterer Befund. Sie möchte sich schützen – und zahlt dafür in ein System ein, das mehr für seine eigene Aufrechterhaltung als für ihren Schutz arbeitet.
Das Beispiel ist kein Einzelfall, sondern typisch für viele junge Berufstätige in sozialen oder handwerklichen Berufen. Es wirft eine unbequeme Frage auf: Ist das noch Versicherung im ursprünglichen Sinne – oder ein Geschäftsmodell, das Sicherheit verspricht, aber vor allem am Beitrag verdient?
Wo bleibt die Transparenz? Und wer sorgt für Fairness?
Ein Blick hinter die Kulissen zeigt: Die Kalkulationen der Versicherer bleiben für Außenstehende weitgehend unzugänglich. Geschäftsberichte geben kaum Einblick, konkrete Risikodaten werden als „Betriebsgeheimnis“ deklariert. Gesetze wie § 314 VAG erlauben es zudem, zugesagte Leistungen im Krisenfall einseitig zu kürzen – ein juristischer Freifahrtschein, der das Werbeversprechen „lebenslange Sicherheit“ infrage stellt. Garantien, die nicht halten, sind kein Schutz – sondern Irrtum mit System.
Der Aktuar – stiller Held in einem undurchsichtigen System
Inmitten dieser Komplexität kommt einer Berufsgruppe eine besondere Rolle zu: dem Aktuar – also dem Versicherungsmathematiker. Doch während viele Aktuare im Dienste der Versicherer arbeiten, sind unabhängige Aktuare wie Prof. Dr. Philipp Schade selten, aber essenziell. Sie bringen Licht in das Rechenwerk der Policen, analysieren objektiv und liefern fundierte Gutachten, die Verbrauchern, Anwälten und Gerichten ermöglichen, überhaupt eine faire Einschätzung der Vertragslage zu erhalten.
Mehrere Gerichtsverfahren konnten durch aktuarielle Expertise Rückabwicklungen oder Nachzahlungen durchsetzen – etwa bei überhöhten Verwaltungskosten, intransparenten Rückkaufswerten oder einbehaltenen Risikoüberschüssen. Doch der Weg dahin ist steinig. Gerichte verlangen exakte Nachweise, Richter sind mit der Thematik oft überfordert, und die Gegenseite argumentiert nicht selten erfolgreich mit schlichter Behauptung.
Wie konnte es so weit kommen?
Dass sich das Versicherungssystem so weit von seinen Ursprüngen entfernt hat, liegt an einer schleichenden Verschiebung: vom Solidarprinzip zur Verkaufslogik. Banken, deren Kerngeschäft einst die Kreditvergabe war, verkaufen heute lieber Lebens- und Rentenversicherungen – wegen der schnelleren Provisionen. Gleichzeitig fehlt es an politischem Willen, das System kritisch zu hinterfragen. Zu viele Versicherer bieten austauschbare Produkte, ohne dass eine Marktbereinigung stattfindet. Und zu viele Verbraucher vertrauen weiterhin auf Broschüren – statt auf Transparenz.
Die Idee der „guten Versicherung“ – Rückbesinnung statt Revolution
Doch wie sieht sie aus, die viel beschworene „gute Versicherung“?
- Sie ist fair kalkuliert: Prämien richten sich nach tatsächlichem Risiko – nicht nach theoretisch maximaler Rentendauer.
- Sie ist transparent: Jeder Euro wird nachvollziehbar erklärt – Kostenstrukturen wie „Gamma“, „Alpha-Gamma“ oder „Stückkosten“ werden offengelegt.
- Sie gibt Überschüsse zurück: nicht als Goodwill, sondern weil sie systematisch entstehen – aus der Differenz zwischen gezahlten und tatsächlich benötigten Beiträgen.
- Sie ist flexibel: Statt 30-Jahres-Verträgen bietet sie Modelle wie die jährlich erneuerbare BU, wie sie der Anbieter bonusleben.de realisiert.
- Sie schützt – und verspricht nicht zu viel: Keine Schein-Garantien, keine einseitigen Kürzungsklauseln, sondern ehrlicher Schutz.
- Sie denkt solidarisch: Ein breites, gerechtes Kollektiv trägt die Risiken – und ermöglicht faire Beiträge für alle.
Mut zur Veränderung – von der Branche, der Politik, der Gesellschaft
Wenn eine solche Versicherung heute Realität werden soll, braucht es Mut. Von den Versicherern selbst, die bereit sind, sich von alten Vertriebsmodellen zu verabschieden. Von Vermittlern, die wieder Berater und nicht nur Verkäufer sein wollen. Von unabhängigen Aktuaren, die unbequeme Wahrheiten sichtbar machen. Und von der Politik, die endlich klare Regeln für Transparenz, Überschussverteilung und Kostenkontrolle schafft.
Und nicht zuletzt von uns allen. Denn Verbraucher, die nicht nur Verträge unterschreiben, sondern Fragen stellen, Hintergründe verstehen und Transparenz einfordern, sind der Schlüssel für ein faires Versicherungssystem von morgen.
Versicherung bedeutet Verantwortung. Zeit, dass sie wieder ernst genommen wird.
Autor: Dr. Thomas Schulte, Rechtsanwalt
Über den Autor:
Dr. Thomas Schulte ist Rechtsanwalt in Berlin und seit über zwei Jahrzehnten als leitender Vertrauensanwalt in bundesweiten Rechtskampagnen tätig. Sein Schwerpunkt liegt auf der Rückabwicklung von Lebensversicherungen sowie der juristischen Durchsetzung komplexer finanzieller Ansprüche. Er vertritt geschädigte Verbraucher gegenüber Versicherungskonzernen und entwickelt mit Aktuaren und Sachverständigen strategisch fundierte Klagekonzepte – mit dem Ziel, Rechtssicherheit und finanzielle Gerechtigkeit herzustellen.
Kontakt
Rechtsanwalt Dr. Thomas Schulte
E-Mail: law@meet-an-expert.com
Pressekontakt
ABOWI UAB
Naugarduko g. 3-401
03231 Vilnius
Litauen
Telefon: +370 (5) 214 3426
E-Mail: contact@abowi.com
Internet: www.abowi.com